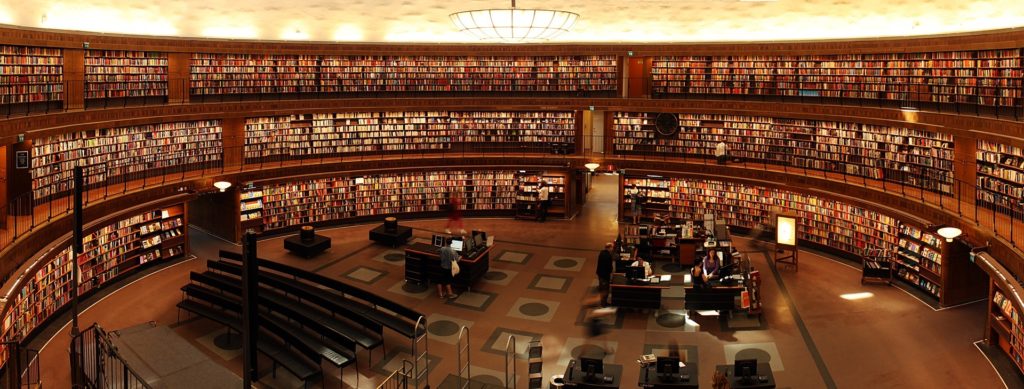NEUES LEITMOTIV
Die New Paradigm Papers des Monats August
Einmal im Monat präsentiert das Forum New Economy eine Handvoll ausgewählter Forschungsarbeiten, die den Weg zu einem neuen Wirtschaftsparadigma weisen.
VON
DAVID KLÄFFLINGVERÖFFENTLICHT
28. AUGUST 2025LESEDAUER
5 MIN.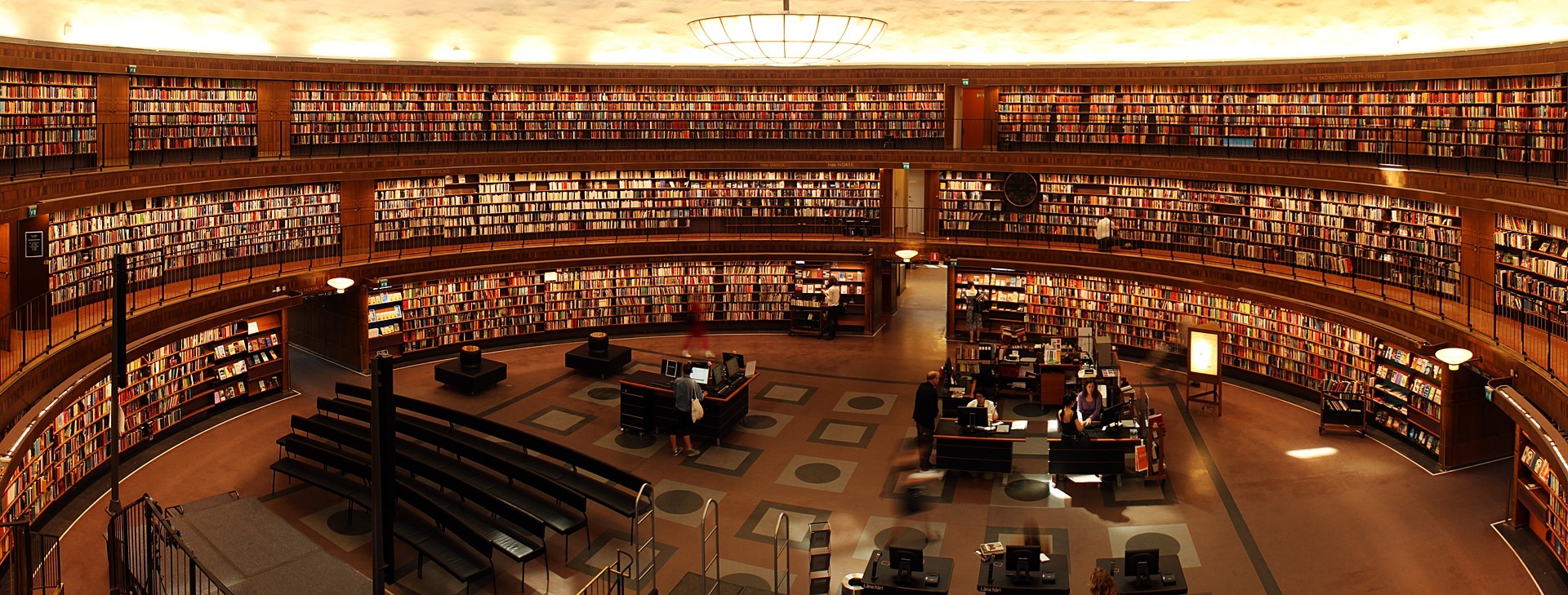
An Estimation and Decomposition of the Government Multiplier
Marius Clemens, Claus Michelsen, Malte Rieth
Öffentliche Investitionen zahlen sich aus. Anhand deutscher Fiskaldaten quantifizieren die Autoren einen Multiplikator von ungefähr 2: Jeder Euro staatlicher Investition generiert rund das doppelte an zusätzlicher Wirtschaftsleistung. Die Effekte wirken über drei Kanäle: kurzfristig durch günstigere private Investitionen, mittelfristig durch höhere Produktionskapazitäten und langfristig durch breitere Nachfrageschübe entlang der Lieferketten. Bemerkenswert ist, dass sich ähnliche Dynamiken auch in anderen Euro-Ländern zeigen – ein Beleg für die zentrale Rolle öffentlicher Investitionen als Treiber privaten Wachstums.
How Much Tax Do US Billionaires Pay? Evidence from Administrative Data
Akcan S. Balkir, Emmanuel Saez, Danny Yagan, Gabriel Zucman
Ein US-Milliardär zahlt weniger Steuern als der durchschnittliche Amerikaner. Durch die Verknüpfung von Forbes-400-Daten mit Steuerakten der IRS schätzt die Studie von Ökonomen rund um Gabriel Zucman und Emmanual Saez, dass die reichsten US-Haushalte einer effektiven Steuerquote von nur 24 % unterliegen – deutlich weniger als Spitzenverdiener mit Arbeitseinkommen. Der Unterschied entsteht, weil das ökonomische Einkommen der Superreichen das steuerpflichtige Einkommen weit übersteigt, während Erbschafts- und Schenkungssteuern kaum ins Gewicht fallen. Steuerliche Vorteile für sogenannte „Pass-through“-Unternehmen und nur begrenzte Effekte durch Spenden verstärken die Schieflage zusätzlich.
Carbon Pricing and Inequality: A Normative Perspective
Saki Bigio, Diego Känzig, Pablo Sánchez, Conor Walsh
In der Theorie sind CO₂-Steuern das effizienteste Instrument. Doch selbst das effizienteste Instrument nützt wenig, wenn es keine politische Unterstützung findet. Ein neues NBER-Arbeitspapier zeigt, dass der Widerstand gegen CO₂-Bepreisung nicht nur populistisch motiviert ist, sondern reale Verteilungseffekte widerspiegelt. Eine Erhöhung der Energiekosten um 1 % durch CO₂-Preise senkt die Wohlfahrt um 1,5 % des jährlichen Konsums – besonders stark bei jüngeren, ärmeren und weniger gebildeten Haushalten. Am härtesten trifft es Süd- und Osteuropa. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer breiteren Klimapolitik, die über CO₂-Preise hinausgeht.
Downward Mobility and Far-Right Party Support: Broad Evidence
Alan Jacobs, Mark Kayser
Der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in Europa wird häufig auf Migration zurückgeführt – politische Antworten konzentrieren sich entsprechend auf immer restriktivere Maßnahmen. Jacobs und Kayser liefern in einer neuen Studie eine differenziertere Erklärung und verweisen auf soziale Abwärtsmobilität. Auf Basis von Daten aus 11 Ländern zeigen sie: Wer einen intergenerationalen Abstieg im beruflichen Status erlebt, hat eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, rechtspopulistische Parteien zu unterstützen. Aufwärtsmobilität hingegen beeinflusst politische Präferenzen kaum. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Statusverlustängste – nicht allein Ideologie – den Aufstieg der Rechten befeuern.
Die Verdopplung des AfD-Elektorats
Andreas Hövermann
Die AfD hat bei der Bundestagswahl 2025 ihren Stimmenanteil verdoppelt und liegt in aktuellen Umfragen vorne. Auf Basis von WSI-Paneldaten zeigt die Studie: Die Wählerbasis der Partei hat sich auf Frauen und Wähler aus der politischen Mitte ausgeweitet, bleibt jedoch besonders stark unter Arbeitern. Zentrale Treiber sind wachsende Sorgen über Migration, Ungerechtigkeitsempfinden und Krisen wie Pandemie und Inflation. Einstellungen gegenüber Geflüchteten haben sich im gesamten Elektorat verhärtet und die AfD über ihre traditionellen Hochburgen hinaus gestärkt.
Rechtfertigt Klimapolitik eine Erhöhung der Verschuldung? Plädoyer für eine grün-goldene Regel
Ottmar Edenhofer, Ulrich Eydam, Maik Heinemann, Matthias Kalkuhl, Nikolaj Moretti
Kann Klimapolitik höhere Staatsverschuldung rechtfertigen? Dieses Papier plädiert für eine „grün-goldene Regel“, die neue Kreditaufnahme an Emissionsreduktionen oder Einnahmen aus CO₂-Bepreisung knüpft. Im Gegensatz zu starren Fiskalregeln würde diese Herangehensweise die Schuldentragfähigkeit an vermiedene Klimaschäden koppeln. Die Autoren berechnen, dass Deutschland bei einem sozialen CO₂-Kostensatz von 200 € pro Tonne bis 2030 zusätzliche Schulden von bis zu 161 Milliarden € rechtfertigen könnte – vorausgesetzt, die Klimaziele werden erreicht.