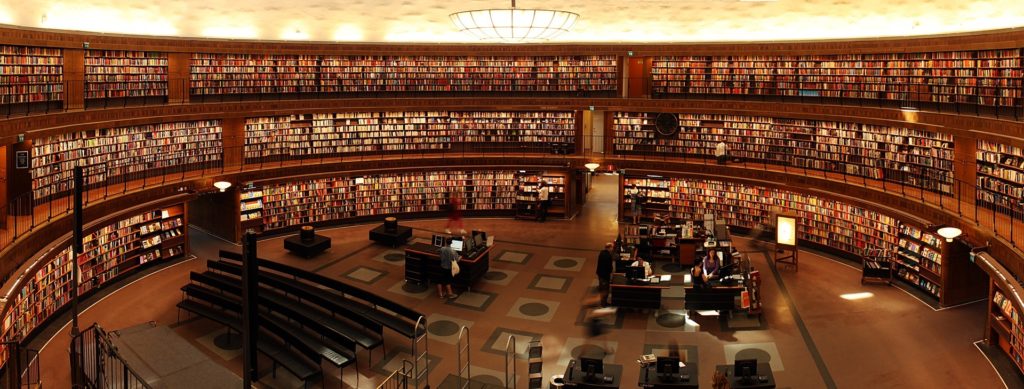NEUES LEITMOTIV
Die New Paradigm Papers der Monate September/Oktober
Einmal im Monat präsentiert das Forum New Economy eine Handvoll ausgewählter Forschungsarbeiten, die den Weg zu einem neuen Wirtschaftsparadigma weisen.
VON
DAVID KLÄFFLINGVERÖFFENTLICHT
15. OKTOBER 2025LESEDAUER
5 MIN.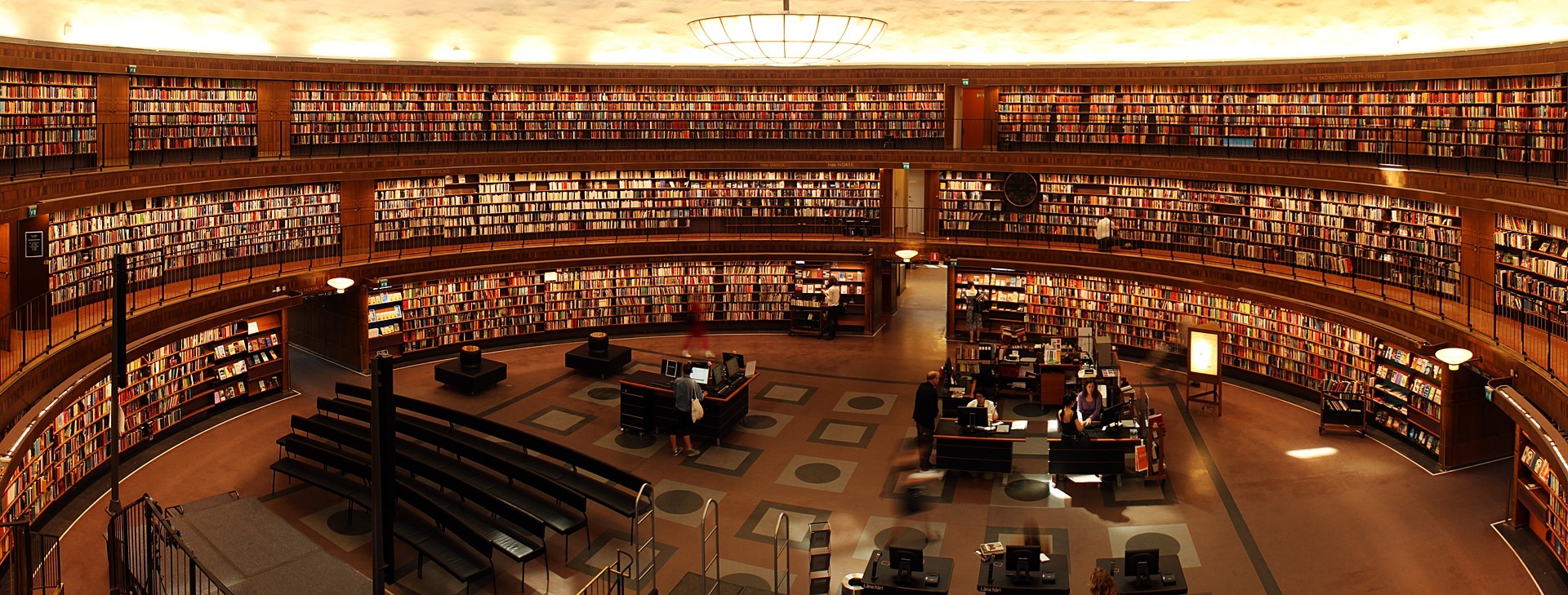
Failing Banks
Sergio A. Correia, Stephan Luck, Emil Verner
Warum scheitern Banken? Die Autoren analysieren US-Banken zwischen 1863 und 2024 und zeigen, dass sich Bankpleiten in der Regel schon vorher ankündigen. Das deutet darauf hin, dass nicht Liquiditätsengpässe (à la Diamond-Dybvig), sondern die Gesundheit von Banken entscheidend sind. Steigende Verluste, sinkende Solvenz und eine zunehmende Abhängigkeit von teurer Fremdfinanzierung kündigen Zusammenbrüche frühzeitig an. Selbst bank runs vor Einführung der Einlagensicherung waren meist Folge schwacher Fundamentaldaten. Niedrige Rückgewinnungsraten bei gescheiterten Banken deuten zudem auf echte Überschuldung hin – nicht auf Panik am Markt. Das Fazit: Bankkrisen sind fast immer und überall das Ergebnis einer realen Erosion der Bankbilanzen.
Playing with Blocs: Quantifying Decoupling
Barthélémy Bonadio, Zhen Huo, Elliot Kang, Andrei A. Levchenko, Nitya Pandalai-Nayar, Hiroshi Toma, Petia Topalova
Entgegen der verbreiteten Annahme, dass die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft schadet, zeigt eine neue Studie: Viele Länder profitieren sogar von der Entkopplung. Der Grund für dieses konterintuitive Ergebnis ist, dass der Handel zwischen geopolitischen Blöcken zwar abnimmt, er aber dafür innerhalb der Blöcke deutlich steigt, was die negativen Effekte zum Teil ausgleicht. Zwischen 2015 und 2023 haben sich laut dieser Studie etwa ein Viertel der Länder stärker an die USA, ein weiteres Viertel an China angenähert – die Hälfte blieb neutral. Der reale Wohlstand stieg im Mittel um 0,4–0,6 %. Gleichzeitig zeigt sich eine gewisse Fehlanpassung – manche Länder wären im jeweils anderen Block besser aufgehoben. Handelspolitische Allianzen folgen also nicht immer rein ökonomischen Interessen.
The Changing Nature of International Trade and its Implications for Development
Pinelopi K. Goldberg, Michele Ruta
Globalisierung verändert sich – und mit ihr die Chancen für Entwicklungsländer. Während Handel in der Vergangenheit durch Wissenstransfer, Reformen und Produktivitätsgewinne Wachstum gefördert hat, bedrohen neue Faktoren wie Automatisierung, Klimawandel und geopolitische Spannungen diesen Mechanismus. Das Papier betont: Klassisches exportgetriebenes Wachstum wird schwerer zu wiederholen sein. Stattdessen könnten Dienstleistungen und grüne Technologien neue Entwicklungswege eröffnen – sofern große Volkswirtschaften die richtigen Weichen stellen.
Who’s Afraid of Tariffs? The Geographic Distribution of Fear and Loss
Huijun Yan, Randall Morck
Als die USA im April 2025 überraschend „Liberation Day“-Zölle verhängten, reagierten die Märkte panisch: Aktienkurse stürzten um über zehn Prozent ab, bevor Washington die Maßnahmen nach einer Woche pausierte. Besonders stark betroffen waren Unternehmen aus republikanisch geprägten Regionen. Die Studie dokumentiert, wie sich Handelsunsicherheit in finanziellen Verlusten niederschlägt, und zeigt die heterogene Wirkung wirtschaftspolitischer Schocks – sektoral, geografisch wie auch politisch.
Laboratories of Autocracy: Landscape of Central–Local Dynamics in China’s Policy Universe
Kaicheng Luo, Shaoda Wang, David Y. Yang
Chinas Wirtschaft ist in aller Munde, doch auch Chinas Politiklandschaft hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten stark verändert. Auf Basis von 3,7 Millionen Regierungsdokumenten zeigt die Studie von David Yang und anderen: Bis 2013 war die Politik stark dezentralisiert – lokale Beamte entwickelten eigene Initiativen. Seither dominiert Zentralisierung: Eigenständige Innovation wird bestraft, die Umsetzung zentraler Vorgaben belohnt. Diese Verschiebung mindert die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen, da zentrale Vorgaben oft nicht zu lokalen Bedingungen passen. Laut der Autoren überwiegen die Kosten der Zentralisierung ihre Effizienzgewinne deutlich.
State Capacity and Infrastructure Costs
Zachary Liscow, Cailin Slattery, Will Nober
Warum sind Infrastrukturprojekte oft so teuer? Laut einer Studie von US-Ökonomen und Juristen liegt ein Hauptgrund in den USA in mangelnder staatlicher Handlungsfähigkeit. Projekte, die von erfahrenen Ingenieuren betreut werden, kosten im Schnitt 14 % weniger – ein Effekt, der die Gehälter dieser Fachkräfte um ein Vielfaches übersteigt. Wenn Know-how durch Ruhestand verloren geht, steigen die Kosten drastisch. Das Fazit ist klar: Gute Verwaltung und personelle Kontinuität sind entscheidend für effiziente öffentliche Investitionen.