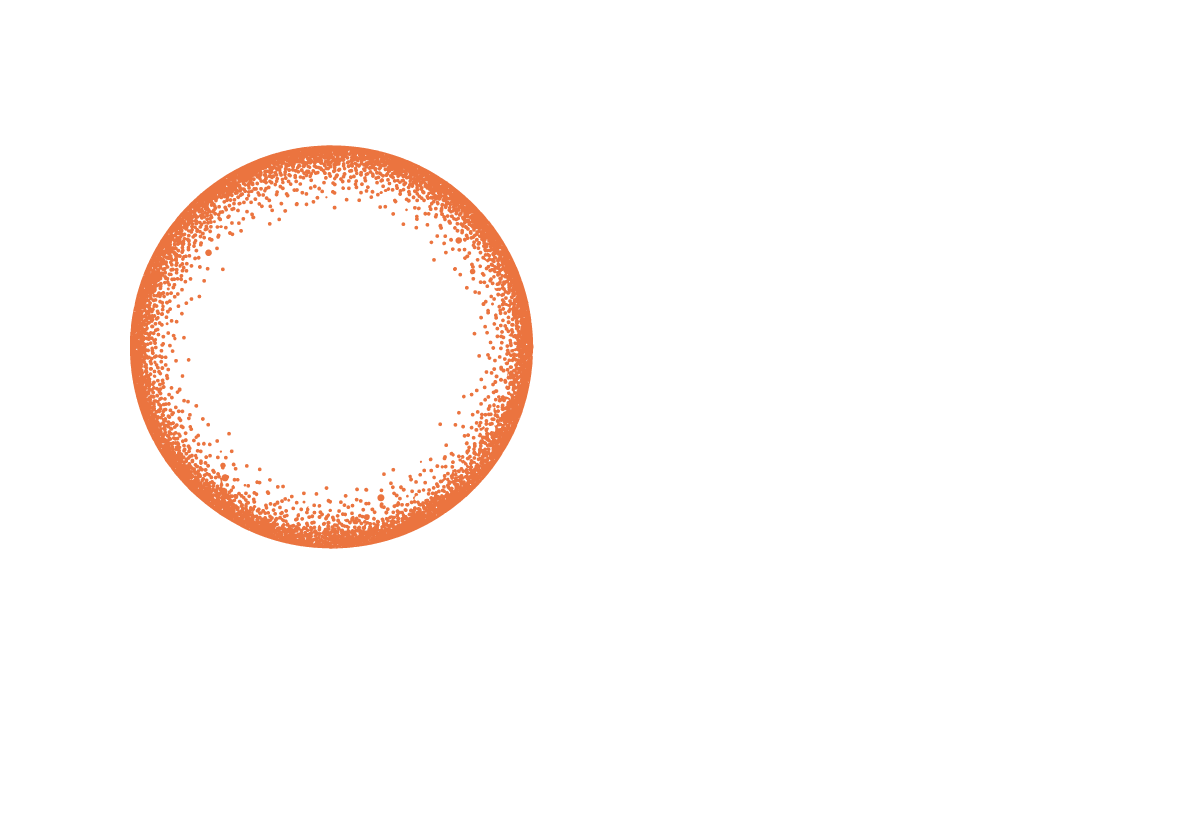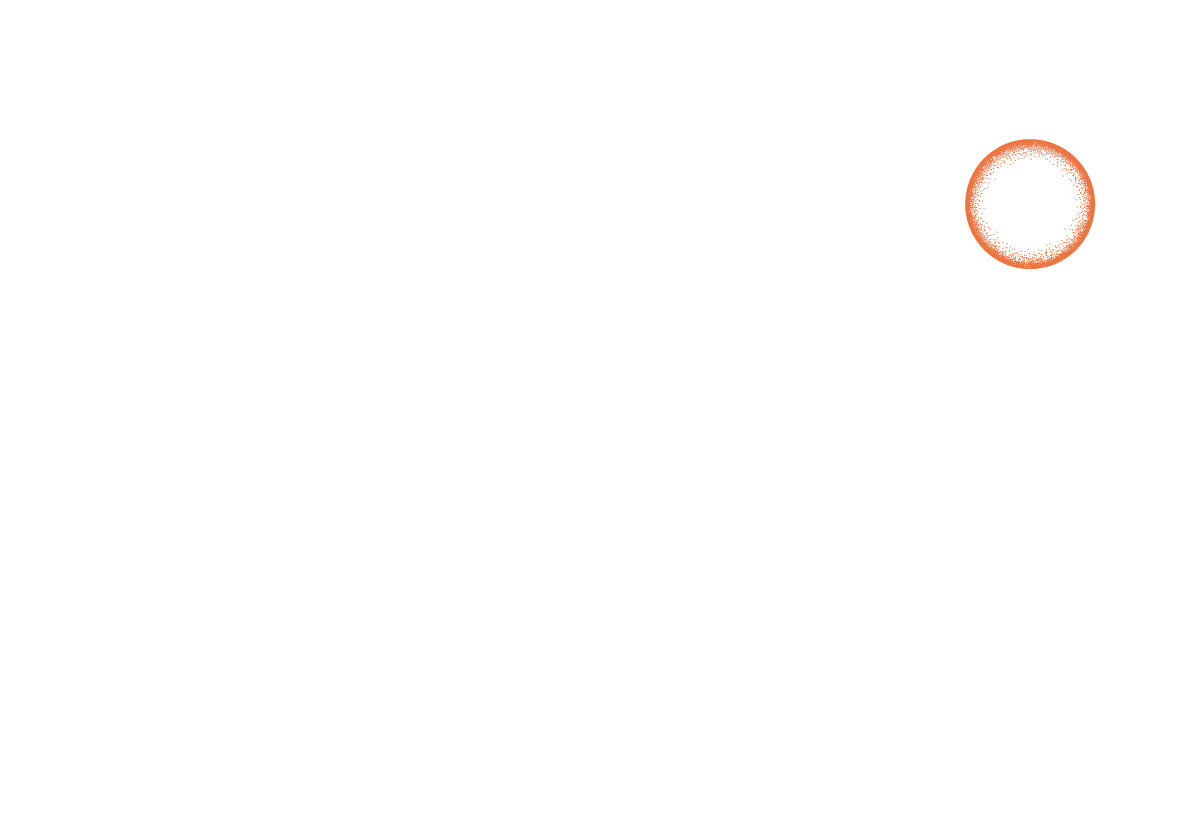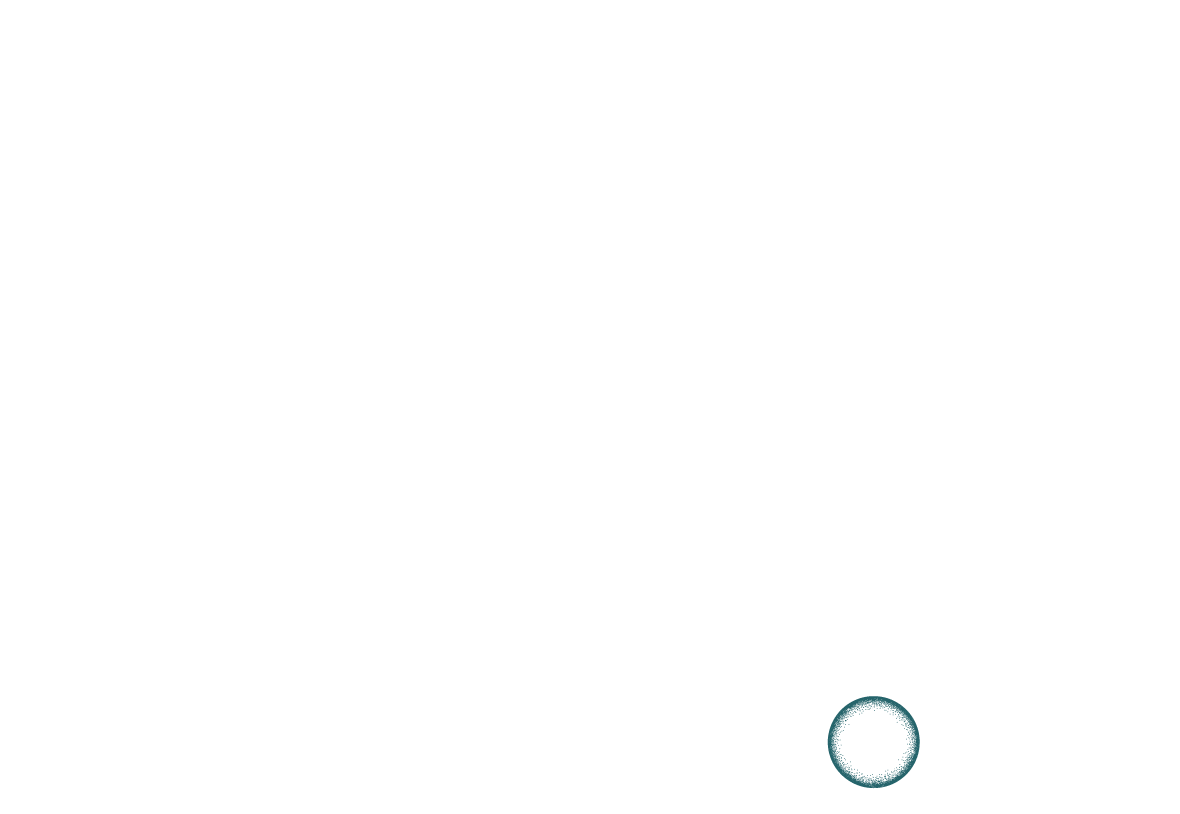Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
America’s Not-So-Great Inflation – Artikel
Barry Eichengreen, Project Syndicate, 10.02.2022
In dem Artikel beschreibt Berkely-Professor Barry Eichengreen, warum die derzeitige Inflation keine Parallele zu der Stagflation in den 70ern darstellt.
„Die Inflation treibt mich um“ – Interview (Paywall)
Lisa Nienhaus & Roman Pletter, Die Zeit, 09.02.2022
Auch in Deutschland steigen die Preise. In dem Interview erklärt der neue Bundesbankpräsident, was er dagegen unternehmen will. Joachim Nagel findet: Erst soll die EZB ihre Anleihekäufe zurückfahren, dann erst Zinsen erhöhen.
Kompliziert und konjunkturell nicht passend: Ampel wird Superabschreibungen wohl verschieben – Artikel
Martin Greive & Jan Hildebrand, Handelsblatt, 09.02.2022
Die Ampelkoalition verhandelt über die Ausgestaltung der Investitionsprämie für Klimaschutz und Digitalisierung. Dabei tun sich Probleme auf. Das Projekt wird sich wohl verzögern.
„Der Stabilitätspakt muss reformiert werden“ – Artikel (Paywall)
Björn Finke & Alexander Hagelüken, Sueddeutsche Zeitung, 06.02.2022
Rettungsfonds-Chef Klaus Regling will den Euro-Staaten Schulden von rund 100 statt 60 Prozent erlauben und einen permanenten Finanztopf für Krisenstaaten schaffen. Das ist Zündstoff für die Bundesregierung.
Die Übergangenen Strukturschwach & erfahrungsstark – Zur Bedeutung regionaler Perspektiven für die Große Transformation – Studie
Paulina Fröhlich, Tom Mannewitz & Florian Ranft, DPZ und FES
Die Welt, und damit auch Deutschland, steht vor einem fundamentalen Wandel, einer Großen Transformation. Das Anliegen der Studie ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie von der Großen Transformation betroffene Menschen zu Mitgestalter:innen der Zukunft werden können. Denn der anstehende Umbruch stellt gerade die Bewohner:innen strukturschwacher Regionen vor besondere Herausforderungen. Aus der Perspektive der Befragten spielt bei den Aufgaben für das Land das Klima zwar eine sehr wichtige, wenn auch nicht dominante Rolle. Noch größere Sorgen bereiten den Menschen soziale Schieflagen wie die soziale Spaltung, der mangelnde gesellschaftliche Zusammenhalt oder Ungerechtigkeiten innerhalb der Gesellschaft.
How Novelty and Narratives Drive the Stock Market – Buchbeschreibung
Nicholas Mangee, INET & Cambridge University Press
‚Animal Spirits‘ ist ein Begriff, der die Instinkte und Emotionen beschreibt, die das menschliche Verhalten in wirtschaftlichen Zusammenhängen bestimmen. In den letzten Jahren wurde dieses Konzept im Zusammenhang mit dem aufkommenden Bereich der narrativen Ökonomie diskutiert. Wenn unvorhergesehene Ereignisse den Aktienmarkt treffen, von Unternehmensskandalen und technologischen Durchbrüchen bis hin zu Rezessionen und Pandemien, ändern sich die Beziehungen, die die Renditen bestimmen, auf unvorhersehbare Weise. Um mit der Ungewissheit umzugehen, lassen sich die Anleger auf Erzählungen ein, die die Komplexität der nicht routinemäßigen Veränderungen in Echtzeit vereinfachen. In diesem Buch wird die Neuheits-Narrativ-Hypothese für den US-Aktienmarkt durch eine umfassende Untersuchung unvorhergesehener Ereignisse anhand einer Big-Data-Textanalyse von Finanznachrichten bewertet.
Thema einer der hitzigsten Debatten der letzten Jahren in der Makroökonomie war die Kontroverse zwischen monetärer und fiskalischer Dominanz. Während orthodoxe Ökonomen Haushaltsdisziplin anmahnen, um die Höhe der Staatsverschuldung zu kontrollieren, argumentieren Verfechter der funktionalen Finanzwirtschaft, dass einer Regierung, die ihre eigene Währung emittiert, nie das Geld ausgehen kann, so dass die Höhe der Staatsverschuldung relativ unwichtig ist.
Jetzt, da die Inflation zurück ist, wird die Debatte um so relevanter, da die Zentralbanken unter Druck stehen, die Zinsen zu erhöhen. Zusätzliche Salienz verleiht ihr der massive öffentliche Investitionsbedarf, der zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele erforderlich ist.
Ein neues Arbeitspapier des Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP) gibt einen Überblick über beide Seiten der Diskussion und zeigt einen Ausweg aus ihr auf. Die drei Autoren Andrew Jackson, Tim Jackson und Frank van Lerven argumentieren gegen eine Rückkehr zur Austerität nach dem Ende der Pandemie und plädieren für mehr Flexibilität und Koordinierung beim Einsatz der Geld- und Fiskalpolitik.
Die ganze Studie gibt es hier.
Vor dem Hintergrund der häufigen Rufe nach Schuldenerlass und Umschuldung veranstaltet die Private Debt Initiative des Institute for New Economic Thinking am Donnerstag, den 3. und Freitag, den 4. Februar 2022 in New York City eine Konferenz zum Thema „Debt Restructuring“. Gastgeber sind Richard Vague (Secretary of Banking and Securities, Commonwealth of Pennsylvania), Rob Johnson (INET President) und Moritz Shularick (INET Fellow).
Die Verschuldung der privaten Haushalte, der Unternehmen und des Staates hat ein Rekordniveau erreicht. Ist diese Verschuldung tragbar? Werden die überhängenden Schuldenlasten das Wachstum im kommenden Jahrzehnt belasten? Welche Rolle kann eine Umschuldung spielen, um eine integrativere Wirtschaft für die Zukunft aufzubauen? All diese und weitere Fragen werden bei der Konferenz diskutiert.
Anmeldung hier.
Heute hat Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck den Jahreswirtschaftsbericht für das Jahr 2022 vorgestellt. Neben den bekannten Kennziffern – der BIP-Prognose, die mit 3,6% geringer ausfällt als noch im Herbst angenommen (4,1%) oder der Inflation, die mit 3,3% höher als zuvor geschätzt (2,2%) ausfällt – ist in diesem Jahr erstmals ein Kapitel „Nachhaltiges und inklusives Wachstum – Dimensionen der Wohlfahrt messbar machen“ im Bericht enthalten. Damit wird das im Koalitionsvertrag festgelegte Vorhaben umgesetzt, eine erweiterte Wohlstandsberichterstattung zu integrieren, die auch Umwelt- und Gerechtigkeitsaspekte berücksichtigt.
Den vollständigen Bericht gibt es hier
Nachdem es jahrelang fast keine Preisbewegungen gab, ist jetzt die Angst vor der Inflation zurück – zusammen mit Debatten über den besten Weg zum Ziel der Preisstabilität. Die konventionelle Wirtschaftspolitik scheint in dieser Frage eindeutig zu sein: höhere Leitzinsen.
Wie der Harvard-Ökonom Dani Rodrik schreibt, gibt es jedoch gute Gründe, warum die Zentralbanken zögern, dieses Instrument einzusetzen: die Vorstellung einer nur vorübergehenden Inflation oder kostspielige Nebeneffekte höherer Zinssätze wie Konkurse. Deshalb standen in den letzten Wochen alternative politische Instrumente im Mittelpunkt hitziger Debatten zwischen Ökonomen.
Dabei stand der Vorschlag der Amherst-Professorin Isabella Weber, alternative Instrumente wie Preiskontrollen stärker in den Fokus der Diskussion zu rücken, im Mittelpunkt der Debatte. Dani Rodriks Rat für diejenigen, die diese Politik sofort ablehnen:
Die Ökonomik ist keine Wissenschaft mit festen Regeln. Unterschiedliche Bedingungen erfordern unterschiedliche Politikmaßnahmen. Die einzig gültige Antwort auf wirtschaftspolitische Fragen lautet: „Es kommt darauf an“.
Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.