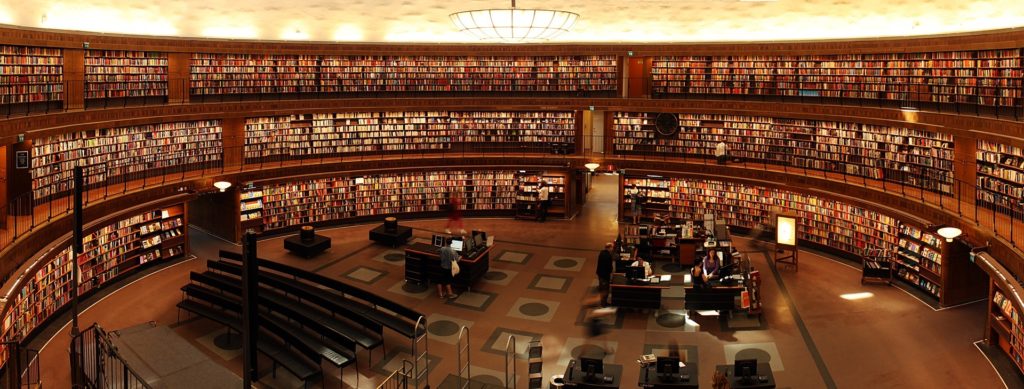NEUES LEITMOTIV
Die New Paradigm Papers des Monats März
Einmal im Monat präsentiert das Forum New Economy eine Handvoll ausgewählter Forschungsarbeiten, die den Weg zu einem neuen Wirtschaftsparadigma weisen.
VON
DAVID KLÄFFLINGVERÖFFENTLICHT
31. MÄRZ 2025LESEDAUER
5 MIN.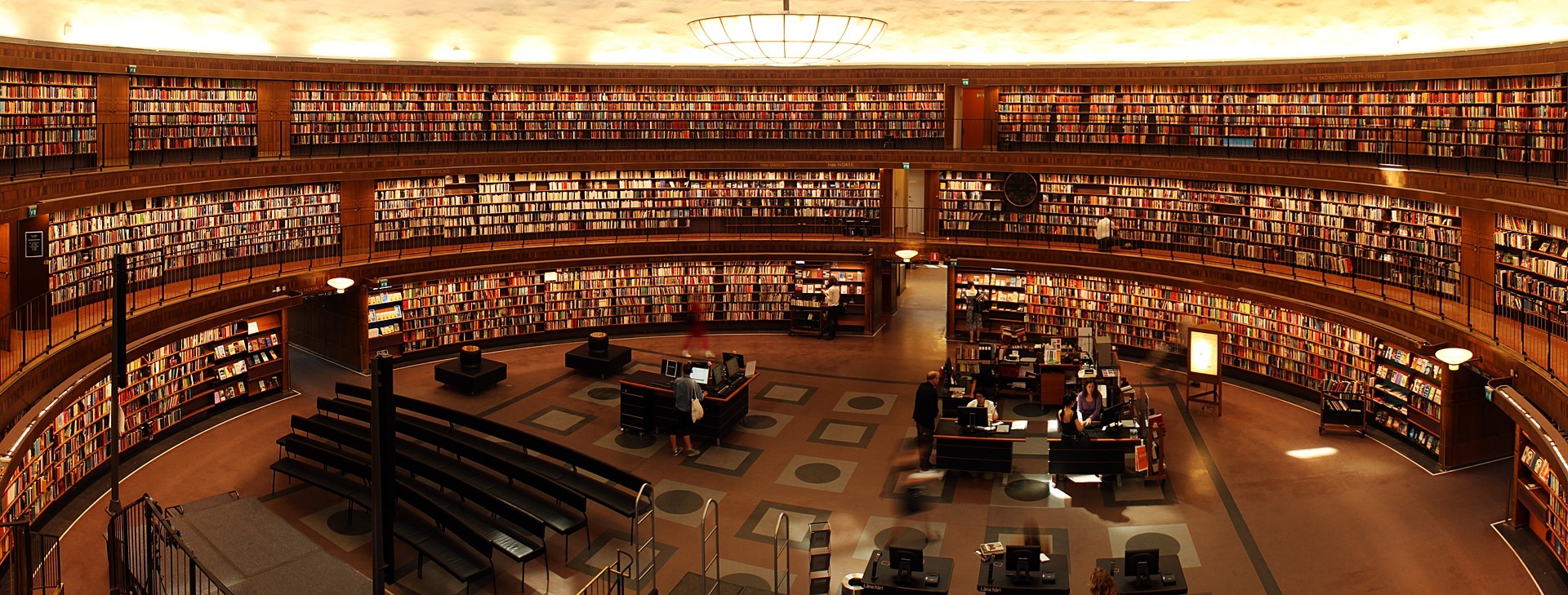
Where Have All the Good Jobs Gone? Changes in the Geography of Work in the US, 1980-2021
Gordon H. Hanson, Enrico Moretti
Die Rückkehr der „guten Jobs“ war ein zentrales Ziel von Joe Bidens Industriepolitik, etwa im Rahmen des CHIPS Act und des Inflation Reduction Act. Gemeint waren damit vor allem klassische Industriearbeitsplätze. Eine neue Studie zum US-Arbeitsmarkt zeigt nun, dass die meisten Arbeitsplätze mit hohen Löhnen nicht mehr im Industriesektor zu finden sind. Für Hochschulabsolventen konzentrieren sich attraktive Jobs heute in wirtschaftsnahen Dienstleistungssektoren und IT. Gute Jobs für Arbeitnehmer ohne Hochschulabschluss gibt es vor allem im Bauwesen. Zudem zeigen die Autoren eine starke räumliche Persistenz der Konzentration guter Jobs, was die Bedeutung von proaktiver Regionalpolitik unterstreicht.
The Compliance Effects of the Automatic Exchange of Information: Evidence from the Swiss Tax Amnesty
Enea Baselgia
Heute gehen etwa 10 % der globalen Unternehmenssteuereinnahmen in Offshore-Steueroasen verloren. Vor der Einführung des automatischen Austauschs von Bankinformationen im Jahr 2017 war globale Steuervermeidung sogar noch weiter verbreitet. Eine aktuelle Studie analysiert nun die Auswirkungen dieser politischen Reform auf die Steuerkonformität in der Schweiz – einem der berüchtigtsten Steuerparadiese der Welt. Mithilfe detaillierter administrativer Steuerdaten liefert der Autor kausale Belege für positive Compliance-Effekte. Die Reform führte dazu, dass Steuerzahler eine Summe von 42 Milliarden Schweizer Franken offenlegten, was 6 % des BIP entspricht. Diese Ergebnisse untermauern die Notwendigkeit einer globalen Koordinierung der Steuerpolitik.
Beyond Tariffs: How Did China’s State–Owned Enterprises Shape the US–China Trade War?
Felipe Benguria, Felipe Saffie
Das „schönste Wort im Wörterbuch“ seien „Zölle“, so US-Präsident Trump. Dieser Tage verhängt die US-Regierung gefühlt jeden Tag neue Handelszölle, was den Blick darauf versperrt, dass sie nicht das einzige Element in Handelsauseinandersetzungen sind. Eine aktuelle Studie, die den US-chinesischen Handelskrieg während der ersten Trump-Regierung analysiert, untersucht die Rolle chinesischer staatseigener Unternehmen: Durch ihre starke Anbindung an die politische Führung des Landes konnten sie gezielt eingesetzt werden, um Handel zu stoppen und der US-Wirtschaft zu schaden. Die Autoren zeigen, dass die Präsenz staatseigener Unternehmen in den chinesischen Importen zusätzlich zu den Auswirkungen der Zölle (8 %) einen erheblichen negativen Effekt auf die US-Exporte (4 %) hatte. Wichtig ist, dass der Rückgang der chinesischen Importe durch staatseigene Unternehmen insbesondere Branchen in US-Regionen mit einem hohen Anteil republikanischer Wähler traf, was den politischen Charakter der Maßnahmen unterstreicht.
Structural Reforms and Economic Performance: The Experience of Advanced Economies
Nauro F. Campos, Paul De Grauwe, Yuemei Ji
Häufig genug verbindet sich mit dem Begriff „Strukturreformen“ der Wunsch nach Deregulierung. Das Argument lautet, dass durch wirtschaftliche Effizienzgewinne letztlich alle an Wohlstand zulegen. In einem Übersichtsartikel, der kürzlich im Journal of Economic Literature veröffentlicht wurde, erklären Paul De Grauwe und Co-Autoren, warum sich dieses Argument in der Realität häufig genug nicht erfüllt.
Erstens bringen Strukturreformen oft weniger Nutzen, wenn grundlegende Marktprobleme bestehen – etwa wenn einzelne Unternehmen eine zu starke Marktstellung haben, Informationen ungleich verteilt sind oder externe Effekte nicht berücksichtigt werden. So kann etwa die Liberalisierung der Finanzmärkte zwar kurzfristig das Wirtschaftswachstum ankurbeln, gleichzeitig aber auch zu übermäßiger Risikobereitschaft und wirtschaftlicher Instabilität führen. Zweitens heben die Autoren hervor, dass es große institutionelle Unterschiede zwischen den europäischen Ländern und den USA gibt – etwa in der Regulierung oder im Sozialsystem –, die es schwierig machen, allgemeingültige Reformempfehlungen auszusprechen.