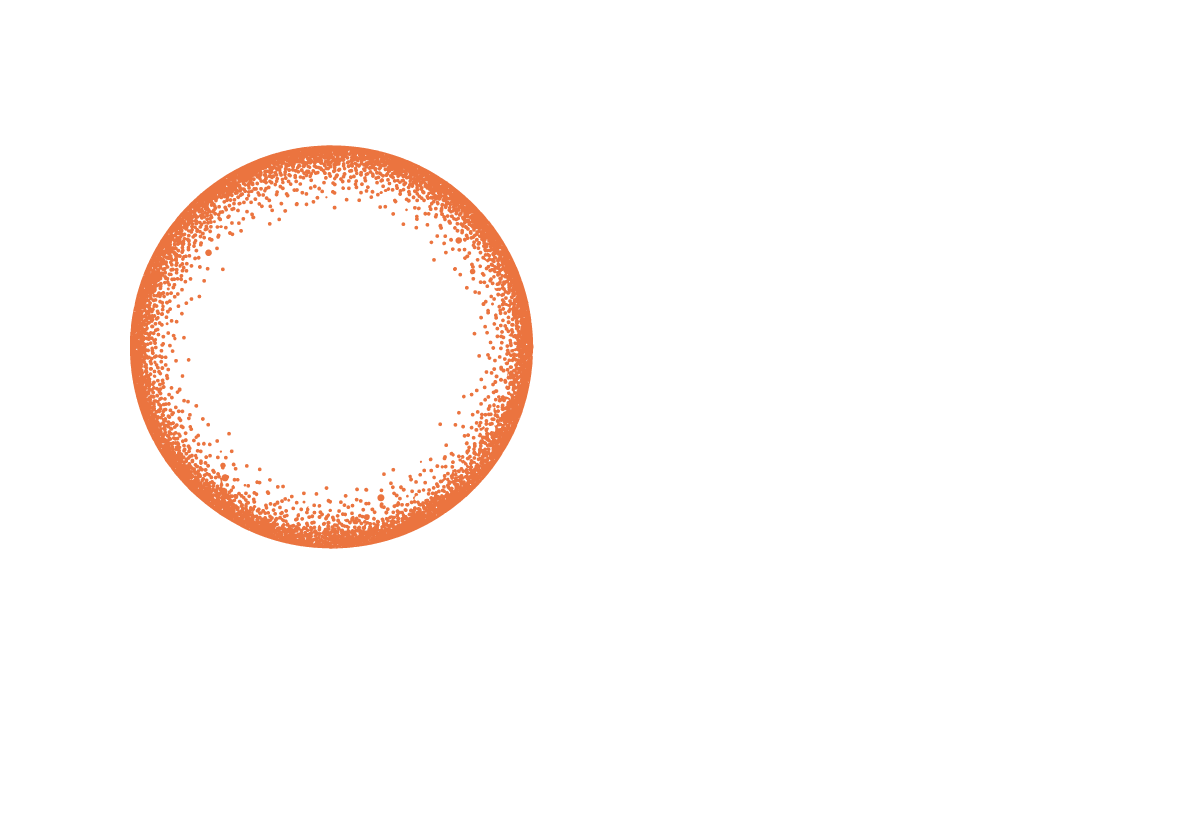Knowledge Base
Finanzwelt erneuern
Auch zehn Jahre nach der Finanzkrise scheint eine wirkliche Stabilität des Finanzsystems nicht in Sicht zu sein. Risiken werden periodisch falsch bewertet und führen zu Boom-Bust-Zyklen. Ein stabileres Finanzsystem sollte kurzfristige Spekulationen erschweren, systemische Risiken begrenzen und das Vermögen gerechter verteilen.
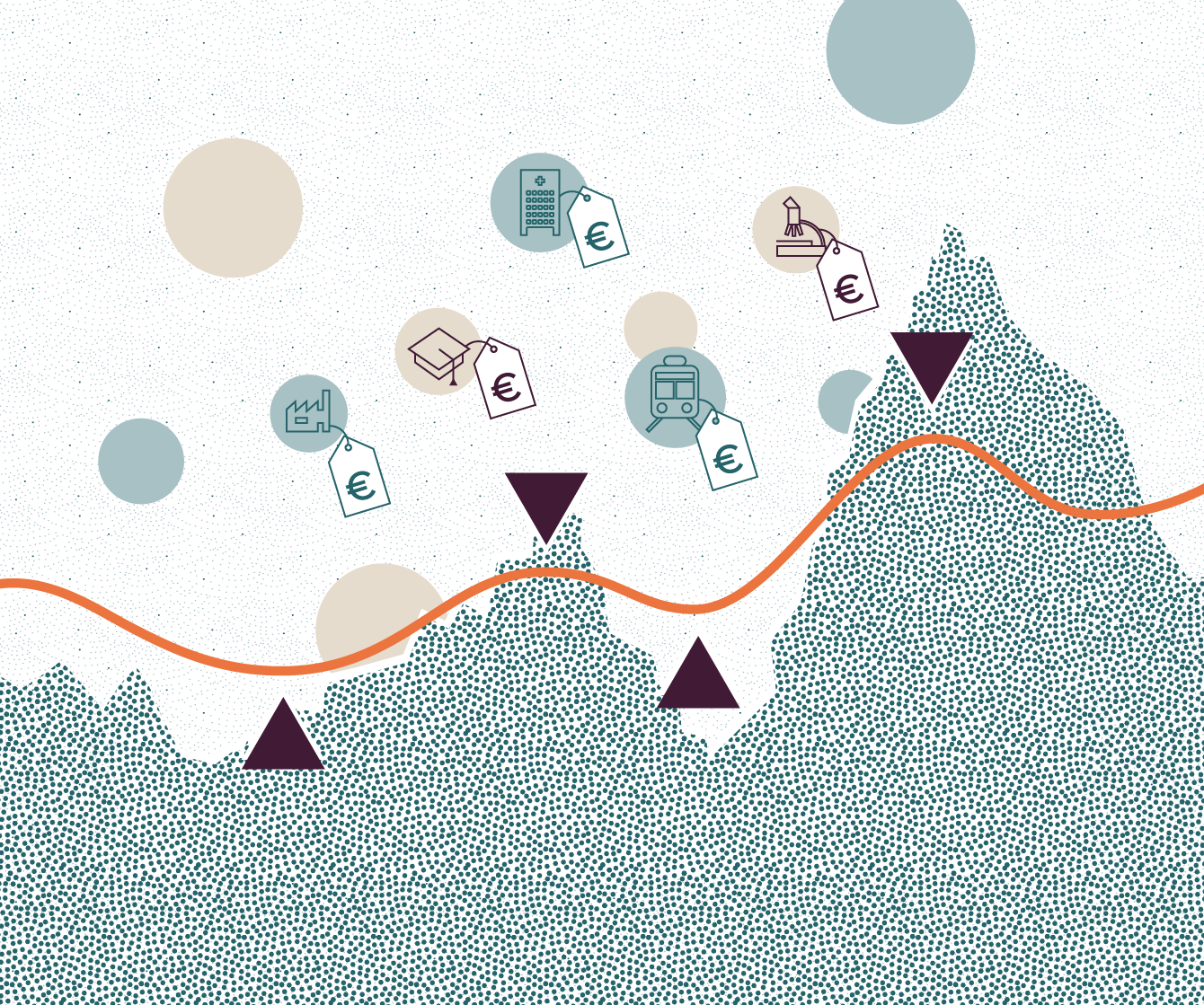
Die Herausforderung
Die globale Finanzkrise von 2008 war die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression, und die Welt leidet immer noch unter der systemischen finanziellen Instabilität.
Mehr als elf Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und dem Beginn der globalen Finanzkrise haben sich die Finanzmärkte noch immer nicht annähernd normalisiert. Auf der einen Seite boomen die Märkte wieder. Im Juli 2019 schloss der Dow Jones mit einem Rekordhoch von 27.359 Punkten, und auch die Aktienmärkte in aller Welt haben neue Höchststände erreicht. Auch die Immobilienpreise haben sich von ihrem Einbruch im Jahr 2008 mehr als erholt. In großen Städten auf der ganzen Welt sind die Immobilienpreise regelrecht explodiert. Die Preise für städtische Wohnimmobilien in Deutschland beispielsweise sind seit 2015 jährlich um mehr als 8,5 % gestiegen (Bundesbank, 2019). Gleichzeitig machen Teile des Finanzsektors wieder große Gewinne, nachdem sie 2008 von den Steuerzahlern gerettet worden waren.
Trotz dieser offensichtlichen Trends scheint mit den Finanzmärkten immer noch etwas grundlegend falsch zu sein. Die fortgeschrittenen Volkswirtschaften stecken heute in einer Welt der extrem niedrigen Zinsen fest, eine Situation, die noch viele Jahre andauern könnte. Die weltweite Schuldenlast nimmt stetig zu, was einige Kommentatoren zu der Befürchtung veranlasst, dass uns bald eine weitere globale Finanzkrise bevorstehen könnte. Die treibende Kraft hinter dem Schuldenanstieg sind – wie schon seit den 1950er Jahren – private Schulden, die vom Finanzsystem emittiert werden, und nicht die öffentlichen Schulden der Regierungen. Die globale Verschuldung erreichte 2017 mit nominal 184 Billionen Dollar einen historischen Höchststand, was 225 Prozent des BIP entspricht. Seit der Finanzkrise wurde diese Entwicklung in hohem Maße durch den Anstieg der privaten Verschuldung in den Schwellenländern, insbesondere in China, vorangetrieben (IWF, 2019). Das ultraniedrige Zinsumfeld scheint für einige Kommentatoren die einzige Möglichkeit zu sein, diesen massiven privaten Schuldenüberhang aufrechtzuerhalten und zumindest ein gewisses Wirtschaftswachstum zu gewährleisten (Turner, 2017, 2019).
Dieses „New Normal“ wirkt sich jedoch auf die Zinsspanne aus, aus der die Banken ihre Gewinne beziehen. Das Risiko einer Insolvenz darf nicht unterschätzt werden, was bedeutet, dass möglicherweise weitere staatliche Rettungsmaßnahmen notwendig werden – mehr als ein Jahrzehnt nach dem Crash sind viele Finanzinstitute immer noch „zu groß, um zu scheitern“. Dies gilt insbesondere für Europa, wo die Banken sehr groß sind und noch immer unter den Auswirkungen der Finanzkrise und der Euro-Krise leiden. Einige große deutsche Banken wurden als „Zombie-Banken“ bezeichnet, weil sie faktisch zahlungsunfähig sind, aber ihre Schulden mit Hilfe von Staatsgarantien verlängern und ausweiten können (Kane, 2017). Noch gefährlicher scheint die Situation in Italien zu sein, das seit einigen Jahren eine versteckte Bankenkrise erlebt. Neue Untersuchungen zeigen, dass solche Krisen zu erheblichen Krediteinbrüchen und dauerhaften wirtschaftlichen Schäden führen können (Baron et al., 2019).
Ein weiteres Risiko liegt in der seit den 1960er Jahren stetig wachsenden Größe des Finanzsektors im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft (Greenwood und Scharfstein, 2013; Phillipon, 2015). Es ist jedoch fraglich, ob der wachsende Anteil des Finanzsektors am BIP durch seinen Beitrag zum langfristigen wirtschaftlichen Fortschritt gerechtfertigt ist.
Es wurde sogar behauptet, dass der steigende Anteil des Finanzsektors auf Kosten von Investitionen in anderen Wirtschaftssektoren und öffentlichen Gütern wie der Bildung erreicht wurde (Temin, 2018).
In diesem Sinne könnte die Finanzialisierung zum globalen Produktivitätsrückgang, aber auch zum Anstieg der Ungleichheit und zur Entwicklung des Rentierkapitalismus beitragen: Einige privilegierte Teile der Bevölkerung leben von Vermögensgewinnen, ohne selbst Vermögen zu schaffen. Wenn man zulässt, dass das Finanzwesen überproportional zum Rest der Wirtschaft wächst, ist das so, als würde man die Kuh der Familie fressen, um ein Steak zum Abendessen zu bekommen“ (Temin, 2018); das heißt, ein kurzfristiger Gewinn geht mit einem langfristigen Verlust einher.
Eine Reihe von Experten hat auch argumentiert, dass die zunehmende Volatilität der Finanzmärkte und der Vermögenspreise das Risiko einer weiteren Finanzkrise erhöht hat, zumal die finanziellen Spillover-Effekte vom Finanzsektor auf die Realwirtschaft und zurück seit der globalen Finanzkrise an Umfang zugenommen haben (Agénor und Pereira da Silva, 2018). Die US-Notenbank hat im September 2019 Mittel direkt in den Finanzmarkt injiziert, um die Zinssätze zu senken, zu denen sich die Banken untereinander Kredite gewähren. Ein solcher Schritt – der erste seit zehn Jahren – ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Risiko einer nächsten Finanzkrise wächst.
Moritz Schularick (Jorda et al. 2015) hat zusammen mit seinen Kollegen argumentiert, dass sich fremdfinanzierte Immobilienblasen als besonders schädliches Phänomen herausgestellt haben, und viele Marktbeobachter warnen heute vor einer Immobilienblase, auch in Deutschland (Deutsche Bank, 2019b; Financial Times, 2019).
Was schiefgelaufen ist
Die Hypothese des effizienten Marktes besagt, dass es keine Blasen geben kann und dass der Markt das beste Disziplinierungsinstrument ist.
Seit mehr als drei Jahrzehnten beruhen die Ratschläge der Wirtschaftswissenschaftler an die politischen Entscheidungsträger auf dem tiefen Glauben an die Effizienz und Stabilität der Finanzmärkte. Man ging davon aus, dass diese Märkte dem Ideal, bei dem die Preise genaue Signale und damit eine effiziente Ressourcenallokation liefern, sehr nahe kommen. Da die Märkte alle verfügbaren Informationen effizient nutzen, um den Preis eines Vermögenswerts zu bestimmen, wurde die Spekulation als eine Möglichkeit zur Stabilisierung der Vermögenspreise angesehen. Der Gedanke, dass Spekulation ein stabilisierender Faktor ist, geht auf Beiträge von Milton Friedman (1953) zurück, der argumentierte, dass Spekulanten Geld verdienen könnten, indem sie auf eine Preisumkehr wetten, sobald sich die Preise von ihrem Gleichgewichtswert entfernen. Auf diese Weise würden die Spekulanten dazu beitragen, die Preise wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Schlussfolgerung war, dass die Finanzmärkte umso näher am idealen Markt liegen, je weniger sie reguliert sind. Das Wachstum des Finanzsektors war somit ein Zeichen für seinen Erfolg und das Finanzwesen ein wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum.

Die wichtigste theoretische Grundlage für dieses stark marktorientierte Paradigma waren die bahnbrechenden Beiträge von Eugene Fama (1965a, 1965b, 1970) und seine Formulierung der Hypothese des effizienten Marktes (EMH). Nach dieser Hypothese spiegeln die Marktpreise immer eine gute Schätzung des inneren Wertes eines Vermögenswertes wider (Fama, 1965a). Dies bedeutete, dass irrationale Abweichungen eines Preises von seinem fundamentalen Wert bestenfalls vorübergehend sein konnten und dass Anleger im Durchschnitt den Markt nicht schlagen konnten. Entweder würden sich die Irrationalitäten der Anleger insgesamt gegenseitig aufheben, oder rationale Spekulanten könnten Geld verdienen, indem sie gegen irrationales Verhalten wetten.
Je mehr ein Vermögenswert gehandelt wird, desto mehr Informationen fließen also in seinen Preis ein. Mit anderen Worten: Eine höhere Liquidität erzeugt mehr Informationen und trägt zur Stabilität der Finanzmärkte bei. Dies war das stärkste Argument für einen wachsenden Finanzsektor, die Erfindung neuer Schuldtitel und Derivate sowie die finanzielle Globalisierung insgesamt. Und es führte zu der Überzeugung, dass Finanzkrisen nur in Ländern mit unterentwickelten Finanzsystemen auftreten können.
Aus dieser Analyse ergab sich, dass die Regulierung der Finanzmärkte am besten dem Markt selbst überlassen werden sollte. Der Markt würde als Disziplinierungsinstrument fungieren (Greenspan, 2003), da die Banken ein Eigeninteresse am Schutz der Interessen ihrer Aktionäre haben sollten. Unter diesem Paradigma konnten irrationaler Überschwang und Kreditblasen einfach nicht existieren. Wie Eugene Fama (2010) in einem Interview sagte: „Ich weiß nicht, was eine Kreditblase bedeutet. Ich weiß nicht einmal, was eine Blase bedeutet. Diese Begriffe sind populär geworden. Ich glaube nicht, dass sie irgendeine Bedeutung haben.“
Schließlich führte der tiefe Glaube an die Effizienz der Märkte zu der Vorstellung, dass das Kapital frei fließen sollte und dass die Finanzmärkte umso effizienter würden, je größer sie seien und je mehr Vermögenswerte gehandelt würden. Eine verstärkte Finanzaktivität wurde als eindeutiger Beitrag zum Wirtschaftswachstum angesehen.
Die globale Finanzkrise hat dem Glauben an effiziente und sich selbst stabilisierende Finanzmärkte einen Schlag versetzt.
Seitdem hat eine wachsende Zahl renommierter Wirtschaftswissenschaftler diese Überzeugung in Frage gestellt. Nach der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression schien klar, dass die uneingeschränkte Finanzwirtschaft ihr Versprechen nicht gehalten hatte. Es war klar, dass ein Zusammenbruch des globalen Finanzsystems im Jahr 2008 nur durch beispiellose Interventionen der Zentralbanken und Regierungen verhindert werden konnte. Die Krise deckte erhebliche Fehlbewertungen von Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem US-Immobilienmarkt auf und machte das systematische Risiko des Bankensektors deutlich.
Dem GFC waren drei Jahrzehnte mit immer häufiger auftretenden Finanzkrisen in der ganzen Welt vorausgegangen, und die Anhänger des damals vorherrschenden Paradigmas hatten frühere Warnungen wohl ignoriert. Die Savings-and-Loans-Krise in den USA in den 1980er und 1990er Jahren, die asiatische Finanzkrise von 1997, die japanische Immobilienblase Anfang der 1990er Jahre und die Dot-Com-Blase zur Jahrtausendwende ließen sich nur schwer mit den Annahmen der EMH in Einklang bringen. Schließlich widersprach auch die zunehmend irrationale Ansteckung der Krise in der Eurozone auf Länder mit sogar soliden Fundamentaldaten zwischen 2010 und 2012 dem EMH-Denken und lieferte einen weiteren Beweis dafür, dass Finanzkrisen ein wiederkehrendes Phänomen sind.
Wenn die Häufigkeit von Finanzkrisen seit den 1970er Jahren zugenommen hat (siehe Grafik), warum gab es dann in den unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnten fast keine Bankenkrisen? Warum treten Krisen häufiger auf, seit die Finanzmärkte dereguliert wurden? Neue Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das Kreditwachstum ein starker Prädiktor für Finanzkrisen ist, bei denen es sich häufig um private Kreditbooms handelt, die dann scheitern (Schularick und Taylor, 2012).
Im Gegensatz zu den Annahmen der Marktfundamentalisten können die Preise von Vermögenswerten über längere Zeiträume von ihrem fundamentalen Wert abweichen. Die Preise werden nicht notwendigerweise von Händlern gebildet, die alle neuesten Informationen berücksichtigen; manchmal extrapolieren sie einfach aus bestehenden Trends. Die Grundlagen für ein mögliches neues und marktskeptischeres Paradigma wurden schon lange vor dem GFC gelegt.
In den frühen 1980er Jahren. Robert Shiller (1981) stellte die Kernannahme der EHM in Frage, als er nachwies, dass die Aktienmärkte viel volatiler waren, als es die Fundamentaldaten der Unternehmen rechtfertigen würden.
Diese empirischen Ergebnisse stützen die einflussreiche, aber umstrittene Ansicht von Hyman Minsky (1977) und Charles P. Kindleberger (1978), dass übermäßiger Optimismus zu einer Kreditexpansion führt. Die Ansicht von Minsky und Kindleberger besagt, dass längere Perioden wirtschaftlicher Stabilität bei den Anlegern übermäßig optimistische Erwartungen wecken, die zu Kreditblasen und damit zu konjunktureller Instabilität führen. Diese Ansicht hat in den letzten Jahren viel empirische Unterstützung erfahren (Baron und Xiong, 2017; Mian und Sufi, 2009; Mian et al., 2017; Fahlenbrach et al., 2017).
Bis 2008 stand die Minsky-Kindleberger-Ansicht am Rande der Wirtschaftswissenschaften. Inzwischen haben die Wirtschaftswissenschaftler jedoch erkannt, dass die Preise nicht immer perfekte Informationen widerspiegeln. In der Tat gibt es Asymmetrien, die sogar zu Marktversagen führen können (Akerlof, 1978; Spence, 1978; Stiglitz und Weiss, 1981). Anleger treffen ihre Entscheidungen über den Preis, zu dem sie bereit sind, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, häufig anhand von „Faustregeln“. Dies kann zu Herdenverhalten führen, da die Anleger durch den Optimismus oder Pessimismus anderer Anleger beeinflusst werden. In der realen Welt sind die starken Annahmen des Paradigmas von vor 2008 nicht haltbar. Wie Kritiker wie Schularick anmerken, sind Spekulationen oft destabilisierend, und das Finanzsystem neigt von Natur aus zu einem Boom- und Bust-Zyklus.
Die jüngsten Erfahrungen in Argentinien sind ein gutes Beispiel dafür. Im Jahr 2017 erlebte der argentinische Immobilienmarkt einen Boom, nur um 2018 eine drastische Preisumkehr zu erleben, die zu einem starken Wertverlust der Währung und der Einführung von Kapitalkontrollen führte (Bloomberg, 2019). Boom- und Bust-Zyklen sind jedoch nicht auf Entwicklungs- oder Schwellenländer beschränkt. Laut dem jüngsten UBS Global Real Estate Bubble Index ist das Risiko einer Immobilienblase in der Eurozone besonders hoch. Die Immobilienpreise in Paris, München, Frankfurt und Amsterdam befinden sich im Bereich des Blasenrisikos und haben Allzeithochs erreicht (UBS, 2019).
New Economy in Progress

Ein besseres Finanzsystem muss Herdentrieb, Booms und Pleiten sowie der inhärenten Tendenz zur Instabilität entgegenwirken.
Neue Forschungsergebnisse zeigen die Kosten von Finanzkrisen und dass ein übermäßiges Kreditwachstum zu finanzieller Instabilität führt. Die Vorstellung, dass ein immer größerer Finanzsektor den Wohlstand der Gesellschaft steigert, wird inzwischen stark angezweifelt. Jüngste wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass das Gegenteil der Fall sein könnte. Ein kleinerer, stärker regulierter Finanzsektor könnte sich positiv auf die Finanzstabilität und die allgemeine Wirtschaftsleistung auswirken. Wie kann uns diese Forschung dabei helfen, ein widerstandsfähigeres Finanzsystem aufzubauen?
Aus politischer Sicht hat der Crash von 2008 gezeigt, dass die mikroprudenzielle Regulierung der einzelnen Banken nicht ausreicht. Die Finanzregulierung und das Risikomanagement konnten sich nicht mehr darauf verlassen, dass der Markt das wichtigste Disziplinierungsinstrument ist, wie es vor der großen Finanzkrise der Fall war. Wenn sich die Marktpreise regelmäßig von ihren fundamentalen Werten entfernen, können marktbasierte Maßnahmen irreführend sein (Yellen, 2017). Ereignisse wie die Immobilienblase in den 2000er Jahren zeigen, dass die Preise über längere Zeiträume von den Fundamentaldaten abweichen können. In diesem Fall war das Bankensystem als Ganzes nicht in der Lage, die Preiskorrektur aufzufangen, als sie schließlich eintrat.
Infolgedessen waren sich die Wirtschaftswissenschaftler einig, dass ein makroprudenzielles Management erforderlich ist. Seit 2008 hat sich die Diskussion hin zu höheren Eigenkapitalanforderungen für Finanzinstitute entwickelt; viele Ökonomen aus dem gesamten politischen Spektrum befürworten nun höhere Eigenkapitalquoten (siehe z. B. Admati und Hellwig, 2014). Obwohl einige Autoren bezweifeln, dass höhere Eigenkapitalquoten die Krisenwahrscheinlichkeit ex ante verringern, deuten die empirischen Belege darauf hin, dass höhere Eigenkapitalquoten die Kosten von Krisen verringern, weil die Erholung von einer Finanzkrise viel schneller erfolgt (Jordà, Schularick & Taylor, 2017). Wir beobachten jedoch nicht nur ein übermäßiges Kreditwachstum während des Wirtschaftswachstums, sondern auch eine übermäßige Kreditverknappung während des Abschwungs.
Das neue Paradigma für das Finanzsystem muss diese Prozyklizität des Finanzsystems anerkennen.
Eine Idee, die in Deutschland und anderen Ländern diskutiert wird, sind antizyklische Kapitalpuffer. In guten Zeiten bauen die Banken ein Kapitalpolster auf, das sie während eines Wirtschaftsabschwungs einsetzen können, um Verluste aufzufangen (BIZ, 2010; Bundesbank, 2015).
Ein weiteres politisches Instrument, das seit 2008 zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, ist die Idee einer Finanztransaktionssteuer (FTT). Intellektuell geht die Idee auf Keynes (1936) und Tobin (1974) zurück und sollte „Körner in die Räder des [Devisen-]Marktes werfen“. Wenn mehr Finanztransaktionen zu finanzieller Instabilität führen, könnte weniger Handel ein stabilisierender Faktor sein. Heute könnte eine Steuer auf Finanztransaktionen mit der Begründung gerechtfertigt werden, dass sie Transaktionen einschränken würde, die negative soziale Auswirkungen haben und zur systemweiten Instabilität beitragen; die Verringerung des Transaktionsvolumens durch eine Steuer könnte für Zsolt Darvas und Jakob von Weizsäcker (2010) eine Option sein.
Schließlich haben Ökonomen und Politiker seit 2008 über die Notwendigkeit einer neuen globalen Finanzarchitektur diskutiert. Einige haben eine neue Version des Bretton-Woods-Systems gefordert, das die Nachkriegszeit geprägt hat. Ein solches System würde aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, zum Beispiel durch die Entwicklung einer internationalen Reservewährung und die Steuerung der Prozyklizität internationaler Kapitalströme (Stiglitz, 2010). Die Gestaltung, Struktur und Umsetzung eines solchen Systems ist jedoch nach wie vor umstritten. Kritiker haben darauf hingewiesen, dass die Konzentration auf ein neues Bretton-Woods-System die Bedeutung großer privater multinationaler Unternehmen, die über nationale Grenzen hinausgehen, außer Acht lässt (Tooze, 2019).
Unabhängig davon, worauf man sich einigt, muss das neue Paradigma möglicherweise ein transparenteres Finanzsystem gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf das sogenannte Schattenbankwesen, und die verflochtene Beziehung zwischen Unternehmen und staatlicher Autorität sowie die Rolle der Zentralbanker demokratisieren.