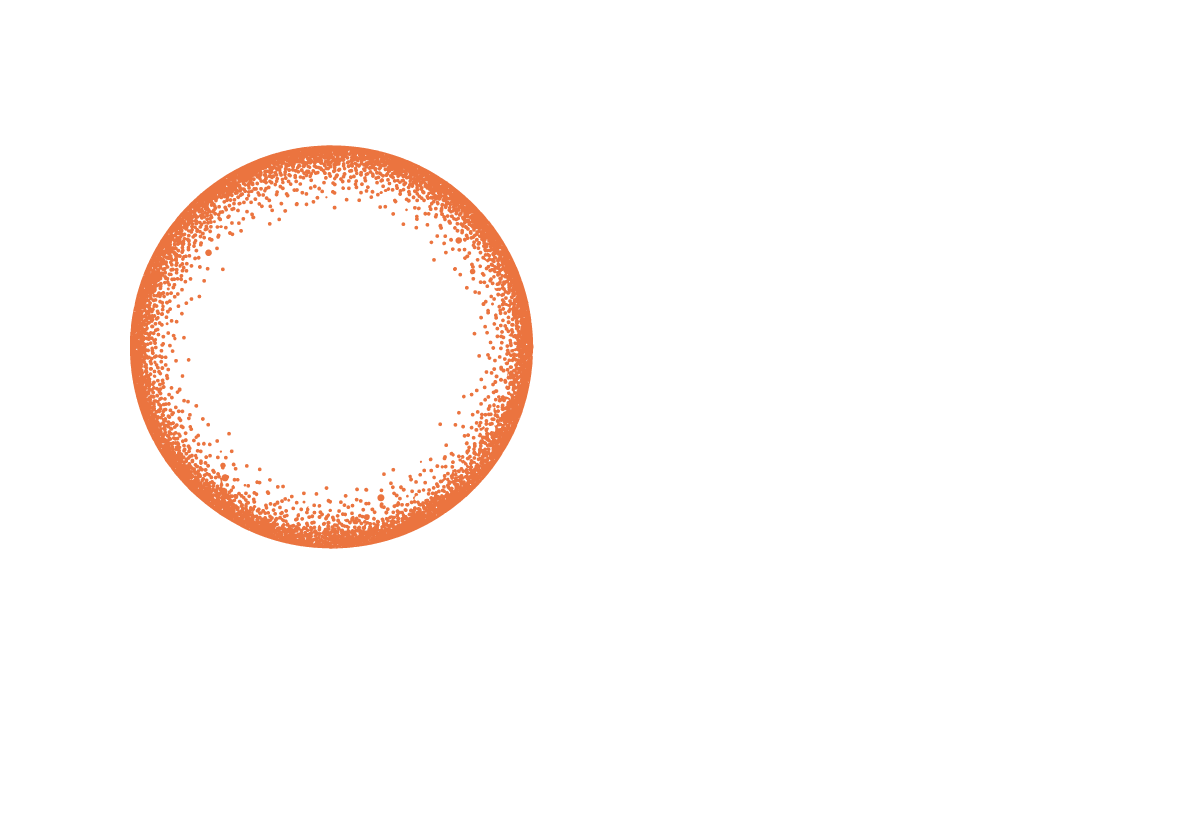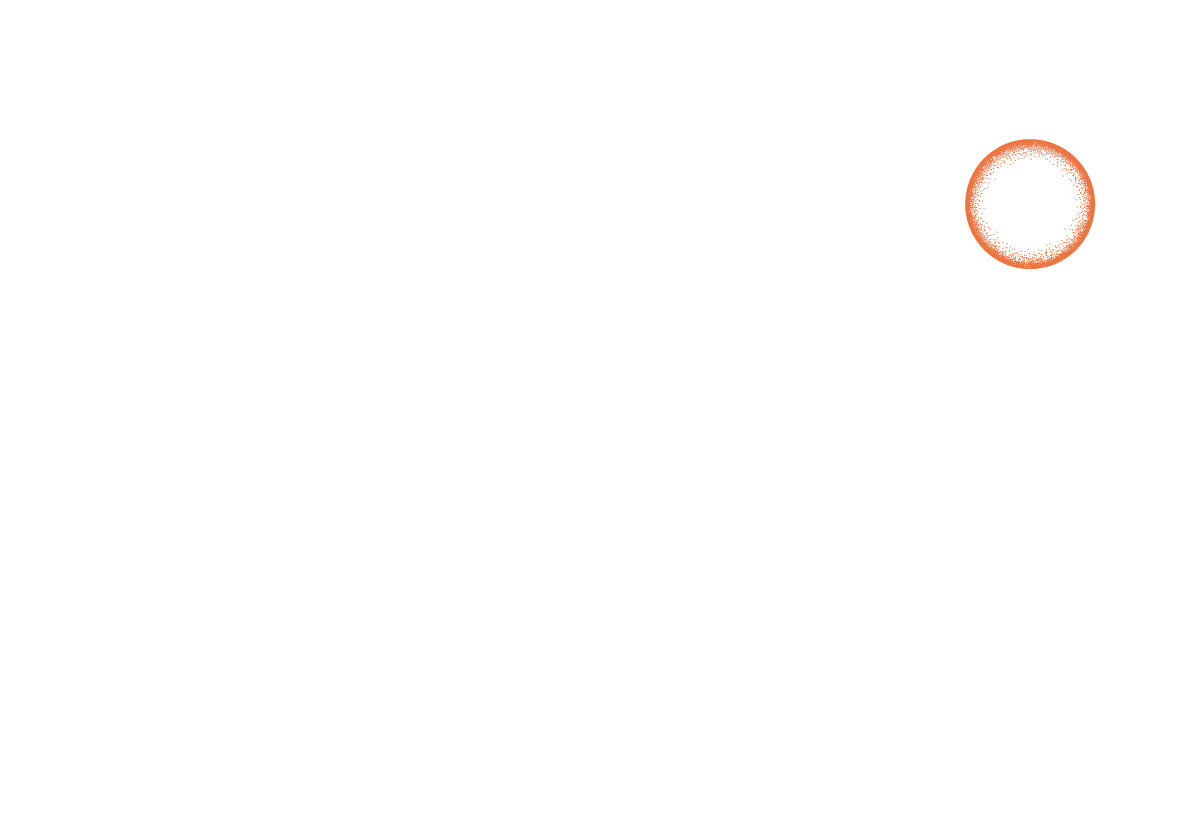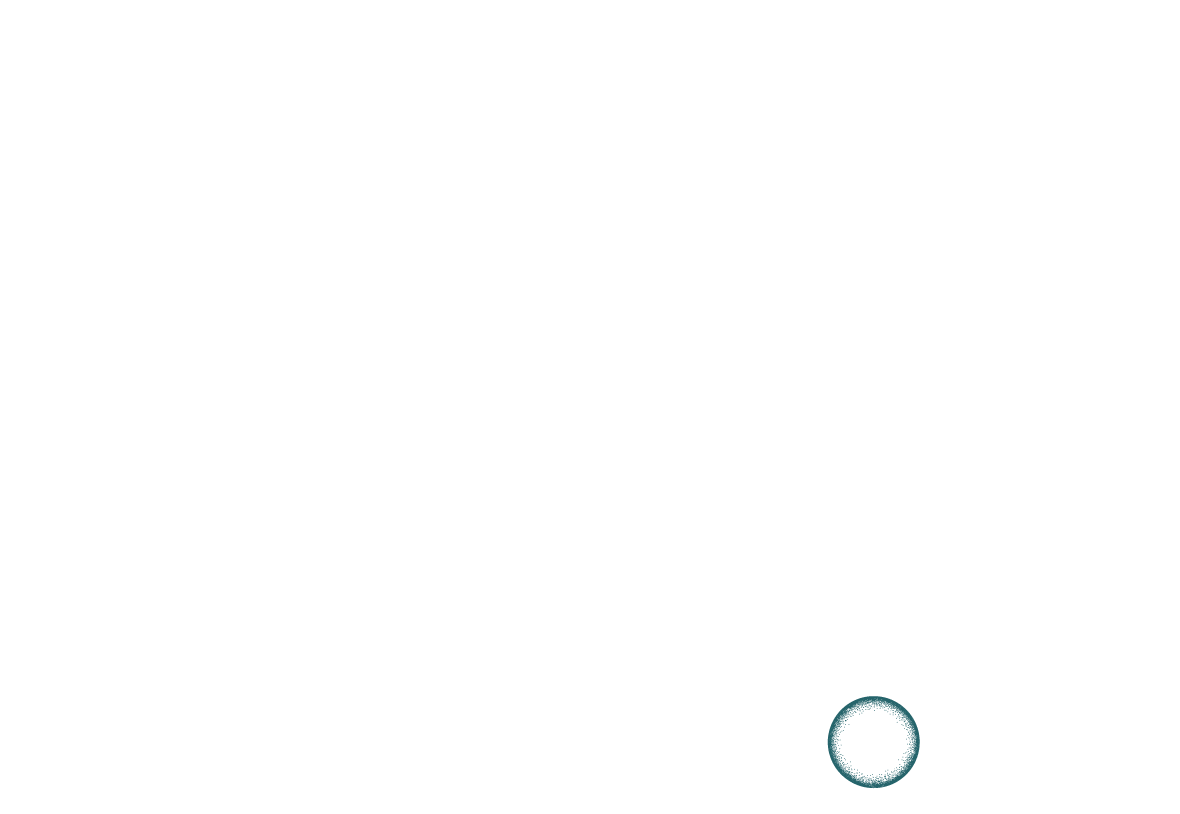Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
The End of Globalization? – Artikel
Adam Posen, Foreign Affairs, 17.3.2022
Was Russlands Krieg für die Weltwirtschaft bedeutet.
Es kommen härtere Tage – Kolumne
Mark Schieritz, Die Zeit, 16.03.2022
Immer mehr Geld – das funktioniert nicht mehr. Christian Lindner muss als Finanzminister den Mangel und damit Verteilungskonflikte verwalten.
Framing in der Wirtschaftsberichterstattung – Artikel
Victoria Teschendorf & Kim Otto, Makronom, 15.03.2022
Eine neue Studie hat untersucht, welche Rolle ökonomische Paradigmen wie „Neoklassik“ und „Keynesianismus“ in der deutschen Wirtschaftspresse spielen. Offenbar ist es im Zuge der Corona-Krise zu einem Sinneswandel gekommen.
Is boycotting Russian energy a realistic strategy? The German case. – Blogbeitrag
Adam Tooze, Substack, 12.03.2022
Wie bewertet man die Effektivität eines ökonomischen Kampfmittels? Wie schätzt man die wahrscheinliche Wirkung auf den Gegner ab? Wie bestimmt man die Kosten für sich selbst?
Die Außenministerien von Frankreich und Deutschland haben zusammen mit der Hertie School und Sciences Po den Henrik Enderlein Preis für herausragende Leistungen in den Sozialwissenschaften ins Leben gerufen.
Der Preis wird jährlich an einen europäischen Forscher unter vierzig Jahren verliehen, dessen Arbeit als herausragender Beitrag auf seinem Gebiet angesehen wird. Mit dem Preis wird der Wert origineller Ideen und Forschungsarbeiten gewürdigt, die sowohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als exzellent angesehen werden als auch für öffentliche Angelegenheiten und den sozialen Zusammenhalt in Europa von Bedeutung sind.
Mehr Informationen gibt es hier.
Hitzige Ökonomen-Debatte: Welche Auswirkungen hätte ein Embargo für russische Energie wirklich? – Artikel (Paywall)
Julian Olk, Handelsblatt, 11.03.2022
Prominente Wissenschaftler fordern ein Energieembargo. Sie meinen, die Folgen seien verkraftbar. Andere Ökonomen sagen, die Rechnung habe Fehler – und unterstützen Vizekanzler Habeck.
Höhere Steuern sind unvermeidlich – es müssen nur die richtigen sein – Kommentar (Paywall)
Bert Rürup, Handelsblatt, 11.03.2022
Nahezu über Nacht benötigt die Bundesregierung viele zusätzliche Milliarden Euro. Die Ampel sollte die Erbschaft- und Schenkungsteuer in den Blick nehmen.
Das „Sondervermögen Bundeswehr“ macht die Schuldenbremse zur Farce – Gastkommentar (Paywall)
Achim Truger, Handelsblatt, 10.03.2022
Die beabsichtigte Grundgesetzänderung zeigt: Die Schuldenbremse ist nicht geeignet, den konjunkturellen und investiven Herausforderungen zu begegnen, findet Achim Truger.
Digital daneben – Artikel
Helmut Martin-Jung, Süddeutsche Zeitung, 09.03.2022
Wie innovativ ist Deutschland? Eine Expertenkommission der Regierung zeichnet ein ziemlich düsteres Bild – vor allem, wenn es um Digitalisierung geht.
Taming the Security Dilemma – Artikel
Dani Rodrik, Project Syndicate, 09.03.2022
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist das Totengeläut für die „liberale“ internationale Ordnung nach dem Kalten Krieg. Es ist jedoch möglich, eine neue, wohlhabende und stabile Weltordnung zu schaffen und dabei realistisch zu bleiben, was die Art des Wettbewerbs zwischen den Vereinigten Staaten, China und Russland angeht.
What If Our Economy Valued What Matters? – Artikel
Mariana Mazzucato, Project Syndicate, 08.03.2022
In einer Wirtschaft, die das Bruttoinlandsprodukt als ultimativen Zweck betrachtet, sind die Menschen und der Planet nur Mittel zum Zweck, und ein Großteil der Arbeit, die die Gesellschaft aufrechterhält, wird völlig ignoriert. Dieser Status quo ist nicht nur pathologisch, nicht nachhaltig und schlecht für unsere Gesundheit, er ist auch völlig unnötig.
Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die USA und die Europäische Union weitreichende Sanktionen gegen Russland beschlossen. Nachdem die Biden-Administration ein Einfuhrstopp von russischem Öl verhängt hat, wird auch in Deutschland vermehrt über die Möglichkeit eines Embargos von russischer Energie diskutiert. Bislang lehnt die Bundesregierung diesen Schritt aus Sorge um die Versorgungssicherheit ab – aber auch wirtschaftliche Verwerfungen werden als Ablehnungsgrund angeführt.
Was wären denn eigentlich die makroökonomischen Konsequenzen eines Importstopps russischer Energie für Deutschland? Dieser Frage gehen eine ganze Riege namhafter deutscher Ökonomen in einem Policy Brief nach – darunter Moritz Schularick, Benjamin Moll, Rüdiger Bachmann, oder Karen Pittel. Laut der Studie, wären die Folgen zwar schwerwiegend, aber handhabbar. Das BIP würde schätzungsweise zwischen 0.2% und 3% zurückgehen, davon abhängig, wie schnell der Gasverbrauch reduziert bzw. substituiert werden kann. Arme Haushalte würden stärker von steigenden Gaspreisen betroffen sein, wobei die Einkommensverluste moderat sind, sodass sie durch gezielte Transfers ausgeglichen werden könnten. Die Autoren schlagen vor, dass die Politik kurzfristige Anreize zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Substitution durch erneuerbare Energien schafft.
Die ganze Studie gibt es hier.
What if Putin’s war regime turns to MMT? Or to wartime Keynesianism? – Blogbeitrag
Adam Tooze, 03.03.2022
Sanktionen sind das Mittel der Wahl des Westens gegen Putins Aggression. Anstatt klein anzufangen, haben wir sofort mit einem Angriff auf die Zentralbank begonnen. Die Frage ist nun, wie schwerwiegend die Auswirkungen der Sanktionen sein werden. Wie schnell werden sie wirken? Wie werden sie sich auf die russische Gesellschaft auswirken und wie könnten sie die Politik des Landes verändern? Wird Russland sein makrofinanzielles Regime des Wall Street Consensus – fiskalische Sparsamkeit, freier Wechselkurs, Finanzierung inländischer Anleihen – aufgeben, das es zur Anhäufung einer Kriegskasse von Währungsreserven eingesetzt hat?
Schuldenregeln der Eurozone sollen erst 2024 wieder voll gelten – Artikel
Spiegel Online, 02.03.2022
Teure Sanktionen und Wirtschaftshilfen, dazu Pläne für eine umfangreiche Aufrüstung: Der Krieg in der Ukraine führt zu steigender Staatsverschuldung. Darauf reagiert die EU-Kommission nun.
Will Russia’s War Spur Trade Diversification? – Artikel
Michael Spence, Project Syndicate, 01.03.2022
In der turbulenten Welt von heute hängt die wirtschaftliche Sicherheit von der Fähigkeit der Länder ab, sich auf ihre Handelspartner zu verlassen. Dies stellt insbesondere die Europäische Union, die sich in der wenig beneidenswerten Lage befindet, in hohem Maße von russischen Energieimporten abhängig zu sein, vor ernste kurzfristige Herausforderungen.
Understanding the social state – Blogbeitrag
Emmanuel Saez, IMF Blog, 01.03.2022
Ihr Wachstum ist ein Rätsel für die moderne Wirtschaft, hat aber tiefe evolutionäre Wurzeln. Der Umfang und die Größe des Staates im Wirtschaftsleben stehen im Mittelpunkt der politischen Debatte. Die auffälligste Entwicklung ist das enorme Wachstum des Staates in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften im 20. Jahrhundert (die Größe des Staates, gemessen am Anteil der Steuereinnahmen am Volkseinkommen). Was machen die Regierungen mit so vielen Steuereinnahmen, was sie vorher nicht getan haben?