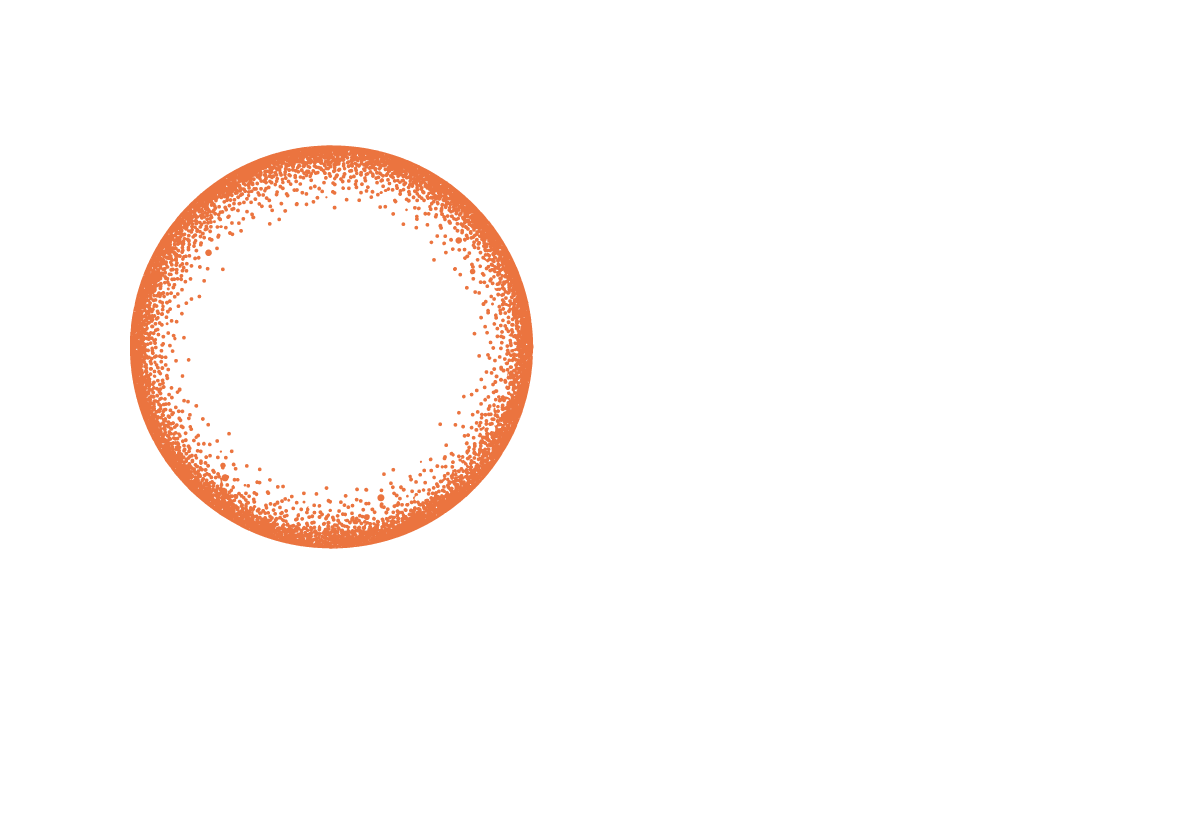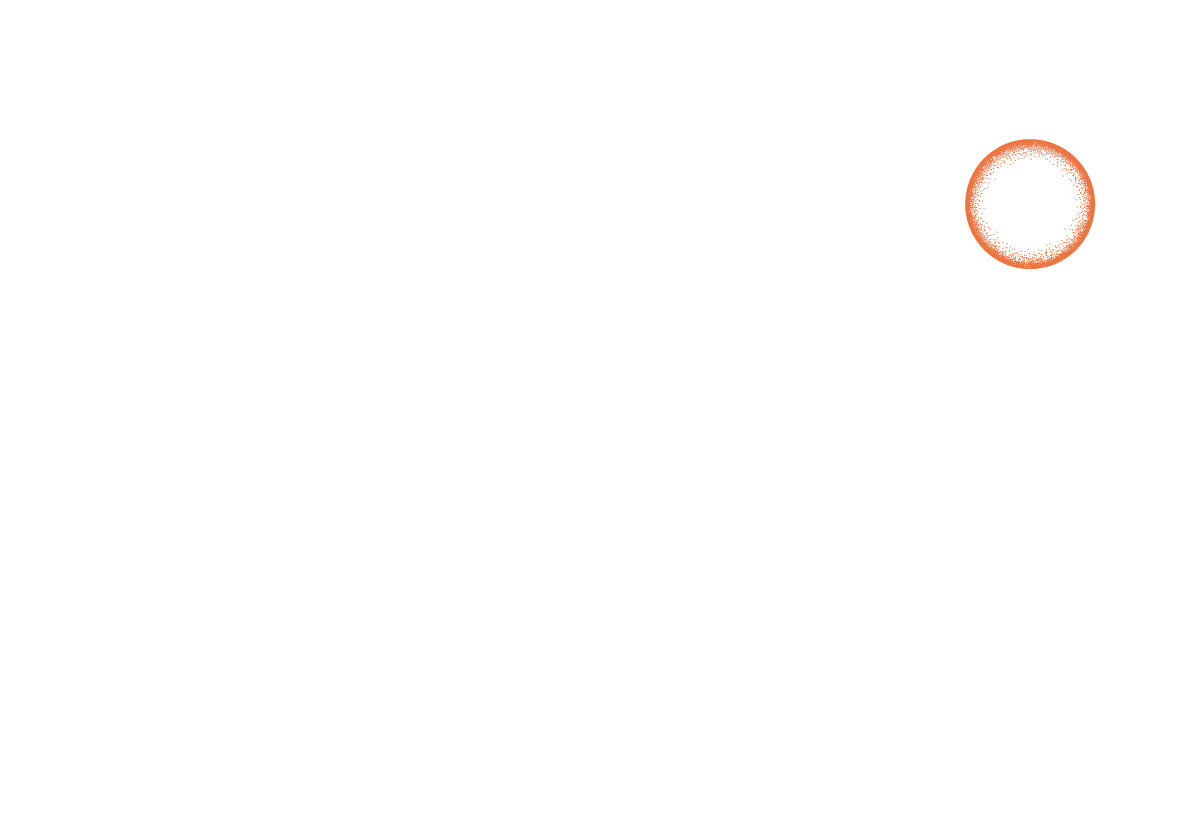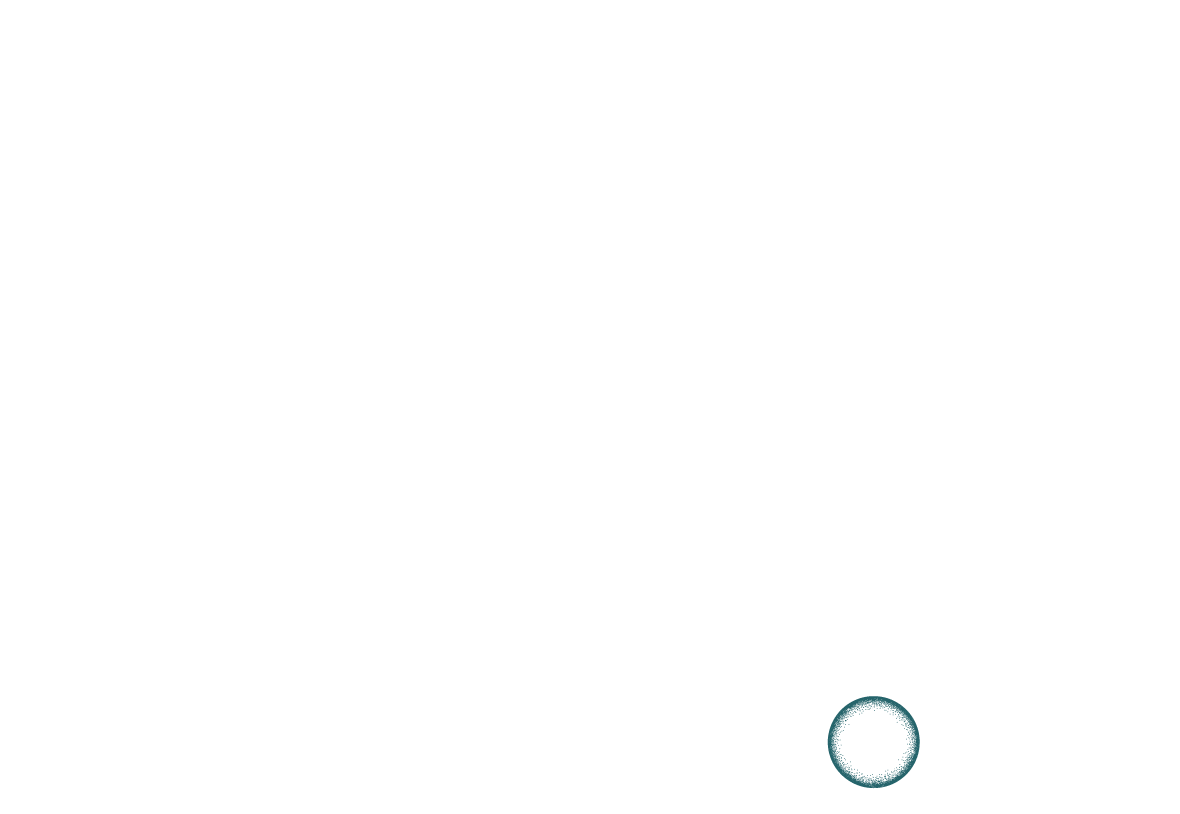Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Christian R. Proaño, Juan Carlos Peña und Thomas Saalfeld von der Universität Bamberg untersucht die Beziehung zwischen Ungleichheit und politischer Polarisierung in fortgeschrittenen Volkswirtschaften.
Die interessanteste Erkenntnis ist, dass sich der Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und politischer Polarisierung in den letzten 20 Jahren deutlich verändert zu haben scheint. Während vor dem Jahr 2000 die Ungleichheit mit dem Erfolg linksextremer Parteien bei Wahlen verbunden war, konnten sich seitdem rechtsextreme (aber nicht linksextreme) Parteien höhere Ungleichheit durch höheren Stimmenzuwachs zu Nutze machen.
Sowohl die durchschnittliche Ungleichheit der Nettoeinkommen als auch der Einkommensanteil der unteren 10 % sind statistisch signifikant, während die Einkommensanteile der oberen 10 % oder der oberen 20 % nicht signifikant sind. Der Zusammenhang zwischen der Einkommensungleichheit und dem zunehmenden Erfolg rechtsextremer Parteien scheint also auf der Verschlechterung der relativen wirtschaftlichen Position insbesondere der ärmsten Bevölkerungsgruppe zu beruhen.
Die vollständige Studie gibt es hier.
Die Studie „Eigentlich europäisch!“ von Das Progressive Zentrum und Heinrich-Böll-Stiftung untersucht, wie die Bundesbürger das Handeln der Bundesregierung und der EU bewerten und welche Erwartungen sie an die Rolle Deutschlands in Europa haben. Die Langzeitstudie erhebt zudem zum vierten Mal in Folge, wie die Deutschen die Rolle ihres Landes in der EU wahrnehmen.
Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage identifizieren die Autoren drei Hauptbereiche der zukünftigen deutschen EU-Politik:
Maßnahmen.
Die vollständige Zusammenfassung der Studienergebnisse gibt es hier.
Am 30./31. Mai findet in Berlin und digital der jährliche Tag der progressiven Wirtschaftspolitik statt.
In diesem Rahmen findet auch die Preisverleihung des Hans-Matthöfer-Preis 2022 für Wirtschaftspublizistik statt samt Laudatio des Jurymitglieds Thomas Fricke statt. Außerdem werden folgende Fragen auf mehreren spannenden Panels u.a. mit Sven Giegold, Moritz Schularick, Martin Sandbu und vielen mehr diskutiert:
Wie bewältigen wir den Modernisierungsdruck in Krisenzeiten? Wie schaffen wir eine gerechte Verteilung von Kosten und Nutzen in der Transformation?
Wie sieht eine neue Wirtschaftspolitik aus, die den immensen Herausforderungen gerecht wird?
Wie können wir Wohlstand und sozialen Zusammenhalt sichern?
Umfrage: Inflation ist die größte Sorge der Menschen in Deutschland – Artikel
Handelsblatt, 16.05.2022
Die rasch steigenden Preise beunruhigen die Verbraucher nach einer Umfrage zurzeit besonders stark. Fast jeder Dritte fürchtet, seinen Lebensstil einschränken zu müssen.
Herr der Rentenlöcher: Das ist der neue Wirtschaftsweise – Artikel
Alexander Hagelüken, Süddeutsche Zeitung, 14.05.2022
Der Ökonom Martin Werding rechnet den Deutschen vor, wie viele Milliarden demnächst in Alters- und Staatskassen fehlen. Seine Berufung wertet das wirtschaftspolitische Gremium der Bundesregierung auf.
A Better Globalization Might Rise from Hyper-Globalization’s Ashes – Artikel
Dani Rodrik, Project Syndicate, 09.05.2022
Mit dem Ende der Hyperglobalisierung nach den 1990er Jahren gibt es verschiedene Szenarien für die Weltwirtschaft. Im besten Fall könnte ein besseres Gleichgewicht zwischen den Vorrechten des Nationalstaats und den Erfordernissen einer offenen Wirtschaft umfassenden Wohlstand im Inland und Frieden und Sicherheit im Ausland ermöglichen.
„Man kann Wohlstand nicht so messen wie Temperatur“ – Artikel
Christina Rebhahn-Roither, Süddeutsche Zeitung, 06.05.2022
Aktuell wird viel über den Wohlstand der Deutschen diskutiert. Warum dieser gar nicht so einfach zu definieren und noch schwieriger zu messen ist.
Staatsschulden sind keine Wachstumsbremse – Kommentar
Philipp Heimberger, Handelsblatt, 26.04.2022
Herausgeber von Journals publizieren häufig Aufsätze mit statistisch abgesicherten Effekten. So werden Regierungen allerdings zum Entschulden animiert, beklagt Philipp Heimberger.
Die beiden untersuchen in der Studie verschiedenen Stränge und Argumente – philosophische, empirische sowie politikbeschreibende – rund um die Wachstumsdebatte und ordnen diese im Hinblick auf die zentrale Frage nach den Grenzen des Wachstums ein. Die Studie kommt zum Schluss, dass die gegenwärtige Debatte am besten als eine Auseinandersetzung zwischen politischen Strategien zu verstehen ist, bei der der Charakter des öffentlichen und akademischen Diskurses eine Schlüsselrolle spielt.
Die Kerngedanken wurden jüngst auch in einem Project Syndicate Artikel zusammengefasst. Den Artikel gibt es hier zu lesen.
Die gesamte Studie kann hier abgerufen werden.