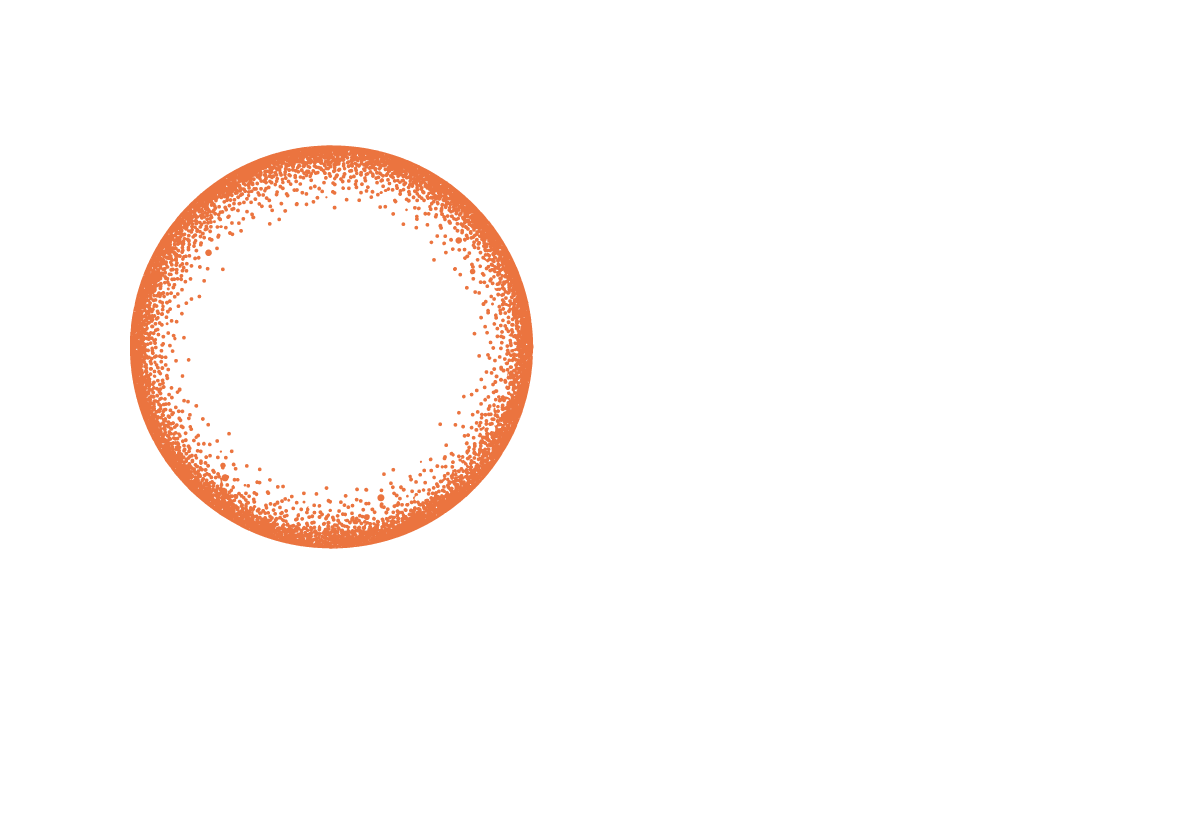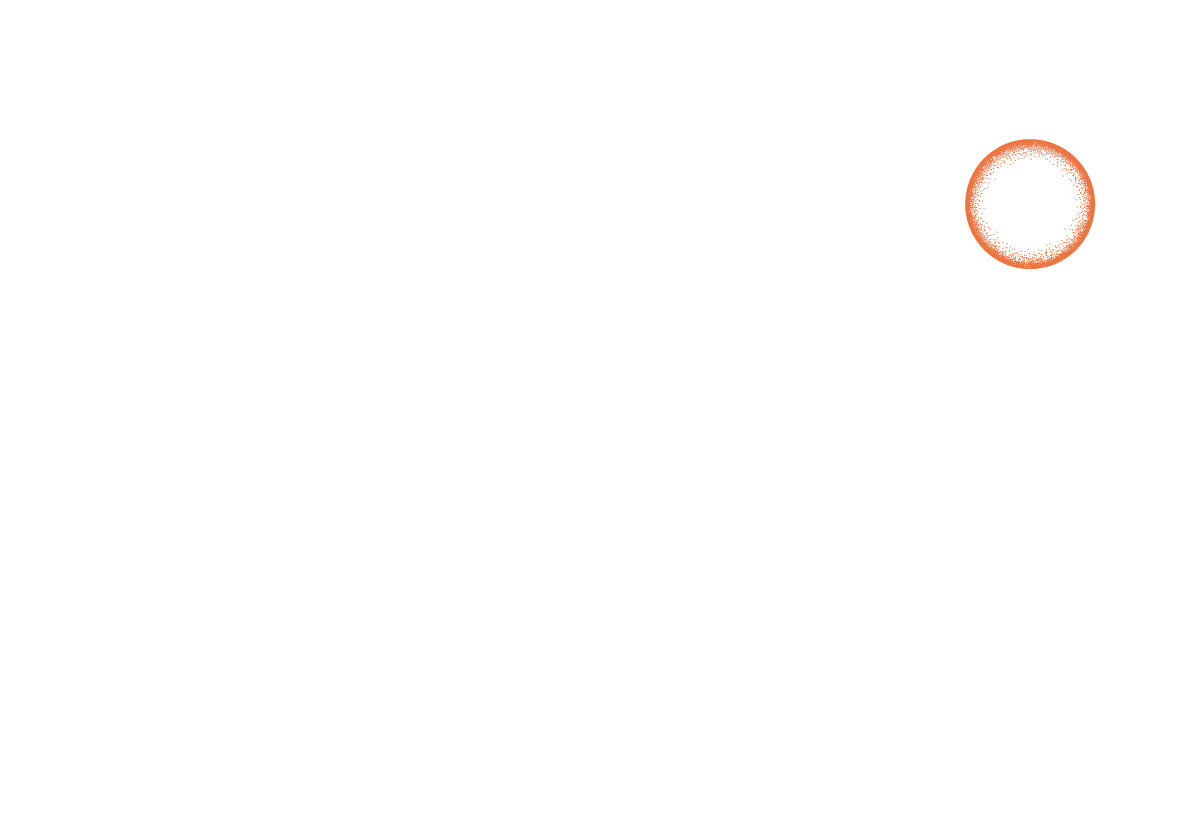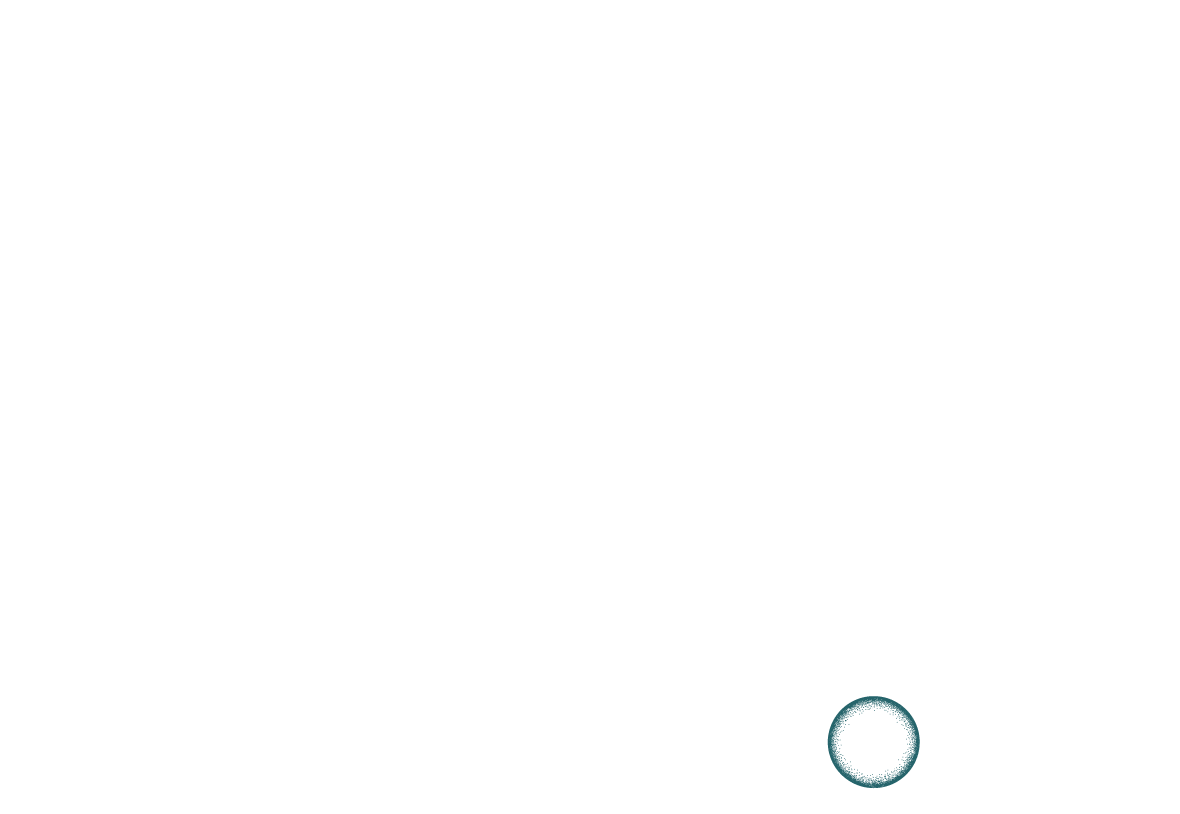Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Was die Weltbank gegen den Klimawandel tun kann – Artikel
Pinelopi Koujianou Goldberg, Project Syndicate, 21.03.2023
Während die Weltbank einen Führungswechsel vollzieht und sich darauf vorbereitet, ihren Auftrag zur Bekämpfung der globalen Erwärmung anzupassen, sollte sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten kann. Neben den finanziellen Ressourcen liegt ihre größte Stärke in ihrer Fähigkeit, evidenzbasierte Lösungen zu entwickeln und sie den politischen Entscheidungsträgern nahezubringen.
A
Eine neue China-Strategie? – Artikel
Michael Hüther, Maximilien Goux, Martin Klein, Britta Kuhn, Ulrich Blum, Wirtschaftsdienst, März 2023
Seit einigen Jahren ist China in Kaufkraftparitäten gemessen die bedeutendste Volkswirtschaft der Welt. Die Dominanz der chinesischen Volkswirtschaft scheint dabei die Industrie- und Handelspolitik der klassischen Industrieländer vor Herausforderungen zu stellen. Spätestens seit der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wird China in den USA und Europa kritischer gesehen. Dabei sind sowohl das chinesische Gesellschafts- als auch das Wirtschaftsmodell Gegenstand kontroverser Debatten. Zudem gewinnt China in Bezug auf die aktuellen geostrategischen Herausforderungen an Gewicht, wie etwa die Spannungen zwischen den USA und China im Lichte der Diskussion um die sogenannte Thukydides-Falle zeigen. Insofern ist es verständlich, dass über eine neue China-Strategie debattiert wird.
Die Unternehmen steigern Gewinne und treiben die Inflation – Wo bleiben die Notenbanken? – Artikel (Paywall)
Torsten Riecke, Handelsblatt, 22.03.2023
Die Währungshüter unterschätzen laut Ökonomen die Bedeutung der Unternehmensgewinne für den hartnäckigen Preisauftrieb. Eine Neubewertung hätte enorme Folgen.
Die Zukunft energieintensiver Industrien – Zwischenbericht aus unserem Industrieprojekt – Studie
Janek Steitz, Dezernat Zukunft, März 2023
Zwischenbericht: Energiekosten energieintensiver Industrien auf dem Weg in die Klimaneutralität – ein internationaler Vergleich.
Die einfachste Lösung für das Bankwesen – Artikel
Jan Eeckhout, Project Syndicate, 23.03.2023
Nach der jüngsten Bankenkrise sollten die Währungsbehörden ernsthaft darüber nachdenken, wie moderne digitale Technologien eingesetzt werden könnten, um solche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Eine digitale Zentralbankwährung würde sowohl viele Hindernisse für Finanztransaktionen beseitigen als auch das Risiko von Bank-Runs ein für alle Mal beenden.
Industriepolitik: komplexe Verflechtungsstrukturen berücksichtigen – Artikel
Simon Junker and Claus Michelsen, Wirtschaftsdienst, März 2023
Die Diskussion über das Ob und Wie einer neuen Industriepolitik wird derzeit intensiv geführt. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet an einer Strategie, mit der die transformativen Aufgaben der kommenden Jahrzehnte bewältigt und gleichzeitig die industrielle Struktur des Landes erhalten werden soll.
Ein weiterer vorhersehbarer Bankenzusammenbruch – Artikel
Joseph Stiglitz, Project Syndicate, 13.02.2023
Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ist sinnbildlich für tiefgreifende Versäumnisse in der Regulierungs- und Geldpolitik. Werden diejenigen, die zu diesem Schlamassel beigetragen haben, eine konstruktive Rolle bei der Schadensbegrenzung spielen, und werden wir alle – Banker, Investoren, politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit – endlich die richtigen Lehren ziehen?
So stellen sich Unternehmen dem Fachkräftemangel – Artikel
Julia Freuding, Johanna Garnitz und Stefan Sauer, Makronom, 16.03.2023
Wenig überraschend ist aus Unternehmenssicht im Kampf gegen den Fachkräftemangel ein umfassendes politisches Maßnahmenpaket nötig. Doch die meisten Firmen haben inzwischen auch erkannt, dass sie selbst aktiv werden müssen, um geeignetes Personal zu finden.
Das 72-Stunden-Gefecht zur Rettung der Vereinigten Staaten vor einer Bankenkrise – Artikel
Jeff Stein, Tony Romm und Gerrit De Vynck, Washington Post, 14.03.2023
Es schien eine einfache Frage zu sein: Hatte der Finanzminister irgendwelche Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Risiken, die von der Silicon Valley Bank ausgingen?
Die Last der Schulden – Artikel
Mark Schieritz, Die Zeit, 16.03.2023
Die Zinskosten im Haushalt hätten sich verzehnfacht, sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner. Das klingt schwindelerregend. Wie kommt er darauf?
Der Fall der Silicon Valley Bank ist ein Plädoyer für digitale Währungen – Kolumne
Martin Sandbu, Financial Times, 16.03.2023
Wozu gibt es Banken überhaupt, wenn wir glauben, dass alle Einlagen sicher sein müssen?
SVB und die Fed – Blogbeitrag
Noah Smith, Noahpinion, 15.03.2023
Finanzielle Dominanz? Auf dem Weg zwischen Inflation und Bankenpleiten.
Wann? 22.03.2023, 15 Uhr (MEZ)
Wo? Online, hier anmelden.
Eine offensichtliche Möglichkeit, die Geschlechterungleichheit in den Wirtschaftswissenschaften zu bekämpfen, besteht darin, einfach mehr Frauen in Führungspositionen innerhalb der Disziplin zu befördern. Doch tiefere strukturelle Hindernisse zeigen, dass diese Option nicht so einfach ist, wie es scheint. Was muss noch getan werden, um die Voraussetzungen für eine echte Inklusivität in diesem Bereich zu schaffen – insbesondere für Frauen aus dem globalen Süden und anderen traditionell marginalisierten Gemeinschaften?
Panel Diskussion:
Wie lässt sich die Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen? – Blogbeitrag
Katharina Wrohlich, Makronom, 10.03.2023
Eine höhere Arbeitszeit von Frauen könnte den Fachkräftemangel abmildern – und außerdem bestehende Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen verkleinern. Politische Instrumente, um diese Ziele zu erreichen, sind seit Jahren bekannt.
Waffen, Schiffe und Chips: Über wirtschaftliche Inflexibilität – Kolumne (Paywall)
Paul Krugman, New York Times, 07.03.2023
Was haben Schiffscontainer und Artilleriegranaten gemeinsam? Das ist keine Fangfrage. Die Antwort ist, dass beide in den letzten drei Jahren zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr knapp geworden sind. Und diese Knappheit sagt uns etwas Beunruhigendes über moderne Volkswirtschaften: Sie sind nicht annähernd so flexibel, wie viele Menschen, mich eingeschlossen, gedacht hatten.
Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Vermögensteuer – Bericht
Alexander Thiele und Hans-Böckler-Stiftung, 07.03.2023
Eine Vermögensteuer ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Angesichts einer hohen Ungleichheit bei der Vermögensverteilung und erheblicher finanzieller Herausforderungen, denen sich die Bundesrepublik ausgesetzt sieht, ist ihre Einführung nicht nur gut begründbar, sie trüge auch zur Verwirklichung grundlegender verfassungsrechtlicher Prinzipien bei.
Die Mauern von Big Tech einreißen – Artikel
Margarethe Vestager, Project Syndicate, 09.03.2023
Jahrzehntelang konnten Tech-Plattformen weitgehend tun und lassen, was sie wollten, und der Schaden, den dieses Vorgehen anrichtet, ist offensichtlich geworden. Glücklicherweise hat sich die Europäische Union für demokratische und humanistische Werte eingesetzt und ist nun dabei, ihren bisher größten legislativen und regulatorischen Beitrag zu leisten.
Wie geht es weiter mit der Globalisierung? – Artikel
Dani Rodrik, Project Syndicate, 09.03.2023
Da die Hyperglobalisierung im Niedergang begriffen ist, hat die Welt die Chance, die Fehler des Neoliberalismus zu korrigieren und eine internationale Ordnung aufzubauen, die auf einer Vision des gemeinsamen Wohlstands basiert. Dazu müssen wir jedoch verhindern, dass die nationalen Sicherheitsapparate der wichtigsten Mächte der Welt das Narrativ an sich reißen.
Wann kommt das Erbe für alle? – Interview
Antje Lang-Lendorff mit Stefan Bach, taz, 07.03.2023
Für einen gerechten Start ins Leben schlägt Volkswirt Stefan Bach ein Grunderbe für alle vor. Ähnliche Modelle im kleinen Stil gibt es anderswo bereits.
Der Verschuldungs-Inflations-Kanal der deutschen Hyperinflation – Studie
Markus Brunnermeier et al. (2023) – März 2023
Unerwartete Inflation kann zu einer Vermögensumverteilung von Gläubigern zu Schuldnern führen. Bei Vorhandensein von Finanzierungsengpässen kann sich eine solche Umverteilung auf die Allokation der realen Aktivität auswirken. Wir verwenden die deutsche Inflation von 1919-1923, um zu untersuchen, wie ein großer Inflationsschock über einen Schulden-Inflations-Kanal auf die Realwirtschaft übertragen wird. Entsprechend der Tatsache, dass die Inflation die reale Schuldenlast reduziert und die finanziellen Beschränkungen lockert, dokumentieren wir eine enge negative und konvexe Beziehung zwischen Firmenkonkursen und Inflation in den aggregierten Daten. Unter Verwendung neu digitalisierter Unternehmensdaten belegen wir außerdem einen signifikanten Rückgang der Verschuldung und der Zinsausgaben während der Inflation. Wir zeigen, dass Unternehmen, die zu Beginn der Inflation mehr nominale Verbindlichkeiten haben, auf dem Aktienmarkt wertvoller werden, geringere Zinszahlungen zu leisten haben und ihre Gesamtbeschäftigung erhöhen, sobald die Inflation beginnt. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit erheblichen realen Auswirkungen der Inflation über einen Finanzkanal, der auch dann wirkt, wenn Preise und Löhne völlig flexibel sind.
Ende Januar stimmte das Europäische Parlament für eine Lockerung der Eigenkapitalvorschriften für Banken. Der neue offizielle Standpunkt weicht erheblich von der ursprünglichen Basel-III-Vereinbarung ab, was gut für die Gewinne der Aktionäre, aber schlecht für die Stabilität der Banken ist. Zahlreiche Ausnahmeregelungen führen dazu, dass die zusätzlichen Kapitalanforderungen bis 2030 lediglich um 4 Prozentpunkte steigen (bis 2033 7 Prozentpunkte), anstatt der erwarteten 20.
Die Gegner der strengeren Vorschriften argumentieren, dass die Umsetzung strengerer Kapitalvorschriften sie im Vergleich zu ihren größeren und profitableren Gegenspielern in den Vereinigten Staaten benachteiligen würde. Dieses Argument der Wettbewerbsfähigkeit wurde auch von Bundesfinanzminister Christian Linder auf dem digitalen Neujahrsempfang der Deutschen Bank vorgebracht, wie in diesem Artikel zitiert:
„Es geht darum, Finanzstabilität, Verbraucherschutz und Wettbewerbsfähigkeit wieder miteinander zu verbinden. Explizit ist auch die Wettbewerbsfähigkeit des Banken- und Finanzplatzes eines meiner politischen Ziele“, sagte er.
Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der regulatorische Wandel in Europa (zumindest teilweise) eine Kapitulation vor der Lobbyarbeit des europäischen Bankensektors ist. Wie eine neue Untersuchung von Finanzwende zeigt, übertrafen die Lobbyisten der Bankenindustrie die Vertreter der Zivilgesellschaft bei Treffen mit der Europäischen Kommission zur Basel-III-Regulierung seit Ende 2019 mit 176 zu 2. Und wie Thierry Philiopponnat, der Chefökonom der europäischen Non-Profit-Organisation Finance Watch, in einer aktuellen Kolumne von Rana Foroohar zitiert wird:
Bestrebungen, die Basel-III-Übergangsregelungen dauerhaft zu machen, „werden die EU-Banken nicht gegen die US-Banken verteidigen, sondern nur die Interessen der europäischen Megabanken gegenüber ihren kleineren europäischen Konkurrenten schützen.“
Somit scheint die herkömmliche Weisheit, dass Amerika bei der Innovation und Europa bei der Regulierung führend ist, in Frage gestellt zu werden.