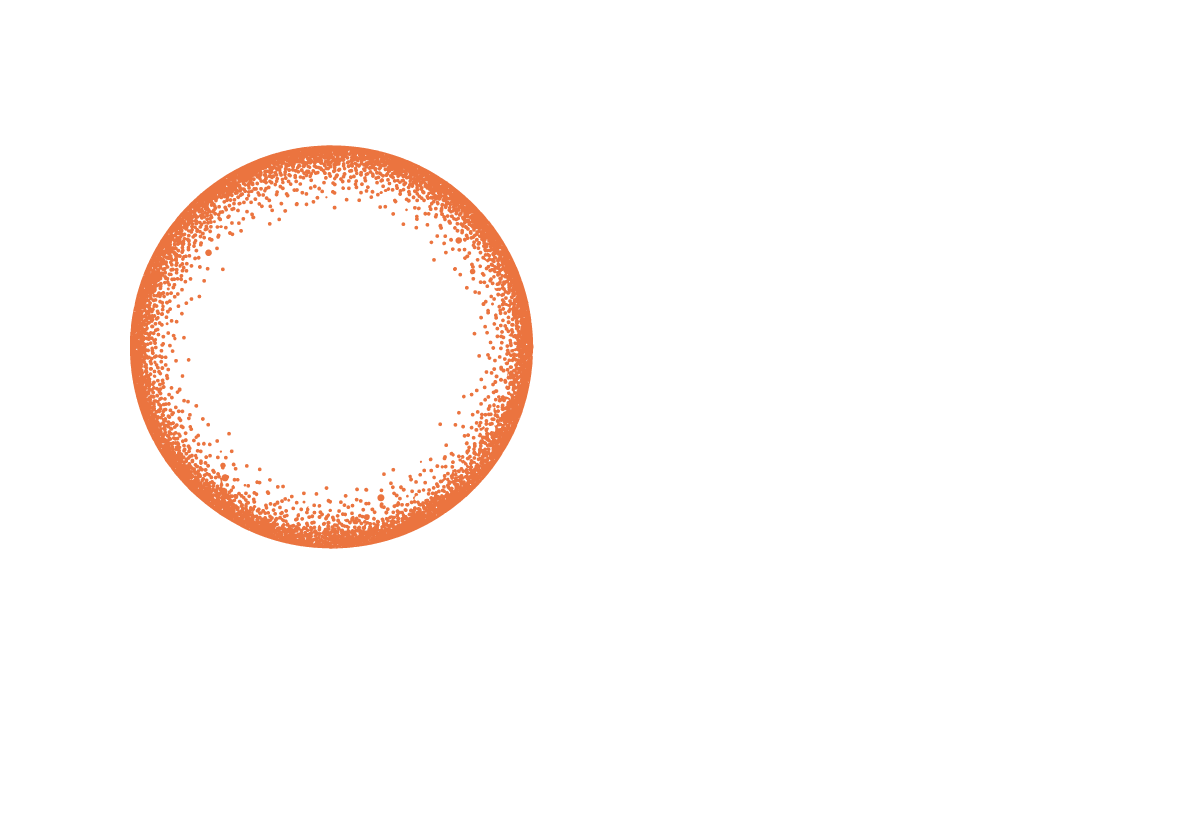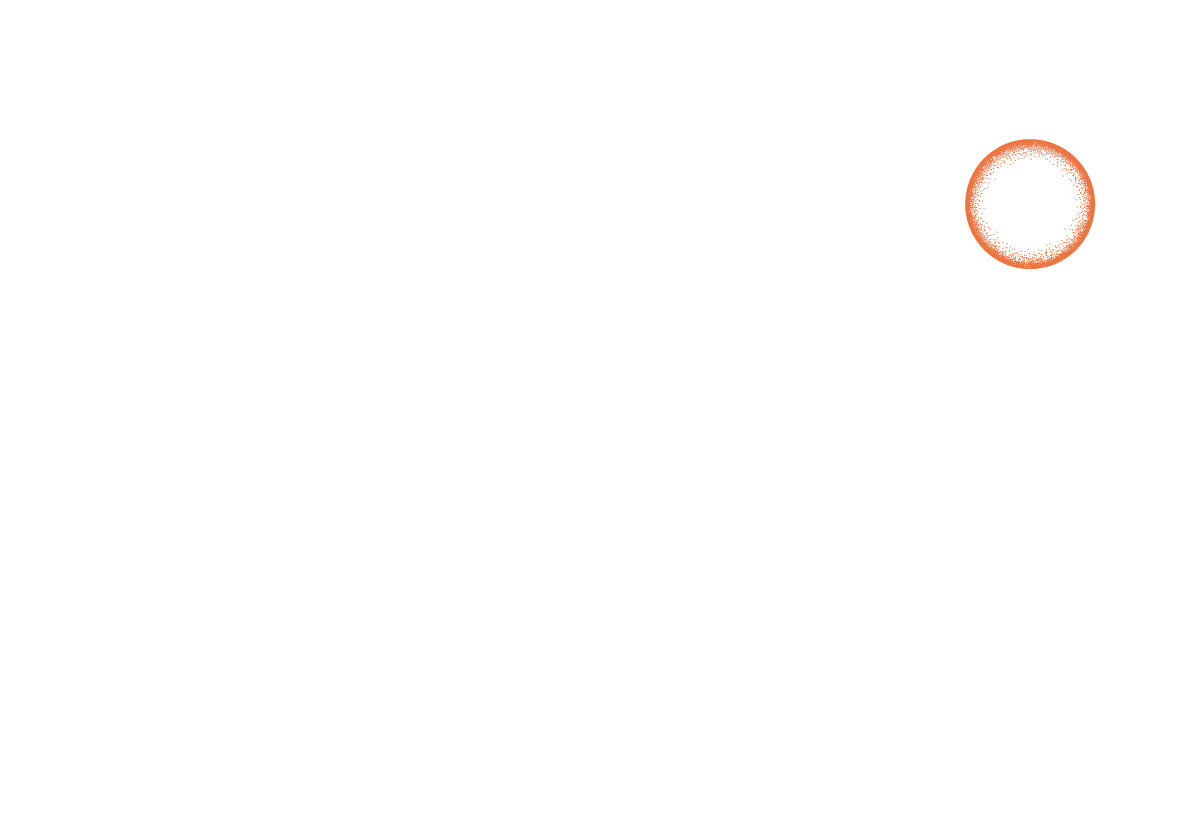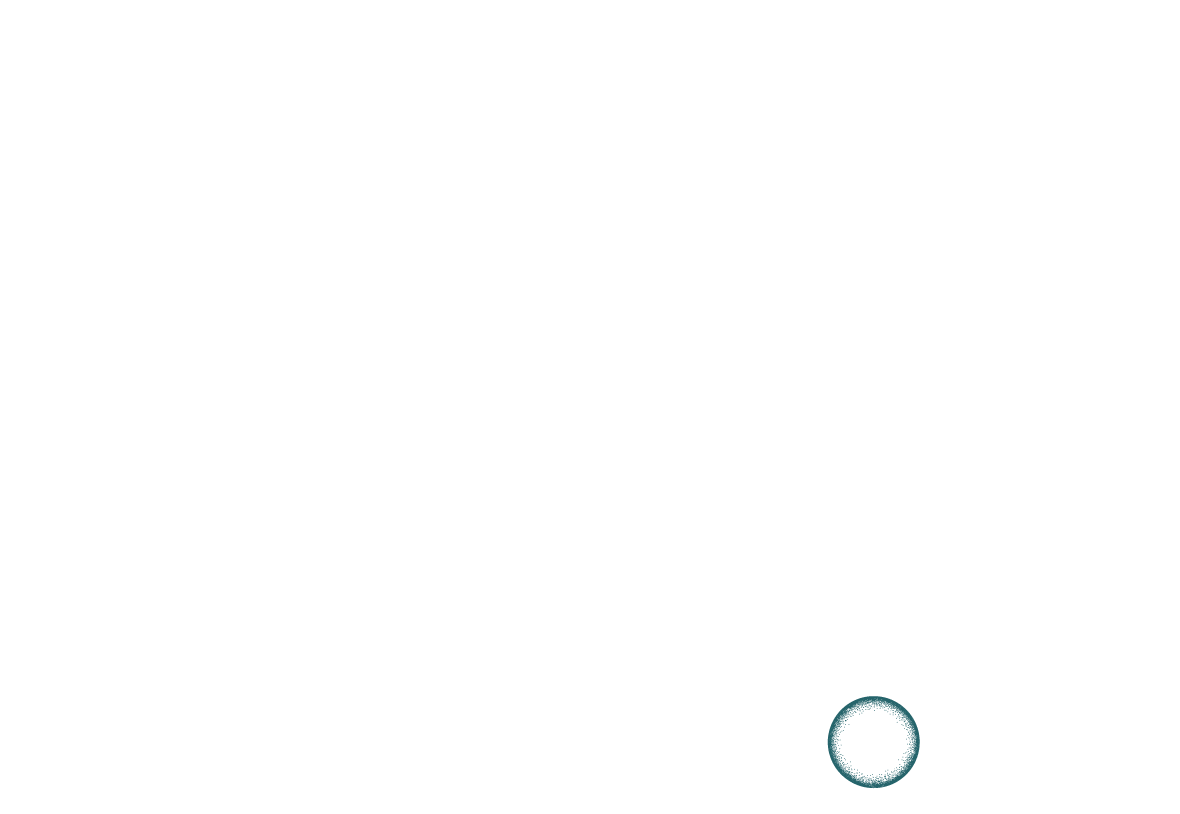Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Ein neuer Policy Brief des Delors Centre geht der Frage nach das der US-amerikanische Inflation Reduction Act (IRA) für Europas Wirtschaft bedeutet. Die Studie quantifiziert welche dramatischen Auswirkungen die US-Subventionen auf Produktionskosten für verschiedene klimafreundliche Technologien in den USA, China und Europa haben könnten.
Der US Inflation Reduction Act (IRA) hat in Europa die Befürchtung geweckt, im globalen Wettlauf um grüne Technologien den Anschluss zu verlieren. Die EU-Mitgliedstaaten sind sich jedoch uneins darüber, ob das größere Risiko in zu viel oder zu wenig öffentlicher Intervention besteht. Im Kern herrscht nach wie vor Verwirrung darüber, welche europäischen Sektoren an Wettbewerbsfähigkeit verlieren werden, wie sehr die EU über diese Verluste besorgt sein sollte, und ob es Unterstützung auf EU-Ebene braucht, um wirtschaftliche Divergenz innerhalb der EU zu vermeiden. Unser Papier unternimmt einen ersten Versuch, die verfügbaren sektoralen Daten hinsichtlich dieser Fragen zu analysieren. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass durch den IRA die europäischen Produktionskosten in mehreren Sektoren unterboten werden. Dies bedeutet nicht, dass die EU das US-Programm imitieren muss. Aber es erfordert, dass die EU ihren bruchstückhaften Industrieplan für den Green Deal in eine kohärente Strategie umwandeln muss. Dies braucht eine stärkere Konzentration auf jene grünen Industrien, in denen Europa einen Wettbewerbsvorteil entwickeln kann, sowie eine stärkere gemeinsame Finanzierung auf EU-Ebene.
Die gesamte Studie gibt es hier.
So ungerecht ist das Vermögen in Deutschland verteilt – Artikel (Paywall)
Markus Zydra, Süddeutsche Zeitung, 24.04.23
Die Vermögen in Deutschland sind extrem ungerecht verteilt. Die zehn Prozent vermögendsten Haushalte besitzen 56 Prozent des gesamten Nettovermögens, so die Bundesbank in ihrem Monatsbericht, der am Montag veröffentlicht wurde. Die vermögensärmere Hälfte der deutschen Haushalte besitzt insgesamt gerade einmal drei Prozent des Nettovermögens.
Extreme Vermögen sind ein ernsthaftes Problem für demokratische Gesellschaften – Interview
Christoph Eisenring, NZZ, 20.04.23
Gabriel Zucman ist das Enfant terrible der Ökonomenzunft. Multinationale Firmen und ihre reichen Besitzer seien die grössten Profiteure der Globalisierung, sagt er – und die steigende Ungleichheit eine Gefahr für die Demokratie. Den Steuerwettbewerb sieht Zucman als das Paradebeispiel für eine schlechte Art von Wettbewerb.
Macron plant Reformen à la Hartz – Artikel
Niklas Zaboji, Süddeutsche Zeitung, 19.04.23
Nach der Rentenreform geht die französische Regierung schon an die nächste wirtschaftspolitische Großbaustelle. Paris macht Druck auf die Sozialpartner und strebt nach Vollbeschäftigung.
Die falsche Wahl zwischen Neoliberalismus und Interventionismus – Artikel
Yuen Yuen Ang, Project Syndicate, 18.04.23
In den vergangenen 40 Jahren haben die Vereinigten Staaten und andere westliche liberale Demokratien eine Politik verfolgt, die den Märkten Vorrang vor staatlichen Eingriffen einräumt. Aber wie China und sogar die USA gezeigt haben, sind Regierungen nicht auf eine binäre Wahl zwischen Laissez-faire und Top-down-Planung beschränkt.
Wie Ungleichheit die Klimatransformation blockiert – Blogbeitrag
Julia Cremer & Vera Huwe, Makronom, 17.04.23
Neue Forschungen zeigen, dass höhere Ungleichheit auch ursächlich für die Klimakrise ist. Notwendig ist daher eine klimasoziale Politik, um die Effektivität von Klimaschutzmaßnahmen zu steigern.
»Kontakte zu Reicheren sind der entscheidende Faktor für den Aufstieg« – Interview
Nicolas Abe, Der Spiegel, 16.04.23
Wer steigt auf im Leben, wer bleibt zurück – und wovon hängt das ab? Der Harvard-Ökonom Raj Chetty hat riesige Datenmengen ausgewertet. Er kann diese Fragen für jede Gegend der USA beantworten.
Mythos Verzicht: So funktioniert Klimaschutz nicht – Essay
Frank Wiebe, Handelsblatt, 05.04.23
Um die Welt zu retten, müssen wir das Wirtschaftswachstum stoppen oder sogar umkehren, heißt es. Das klingt plausibel, lenkt aber nur von einer konsequenten Klimapolitik ab.
Schuldenregeln bringen einen grundlegenden Zielkonflikt zwischen Durchsetzbarkeit und Flexibilität mit sich. In einem kürzlich veröffentlichten Artikel scheint es dem deutschen Finanzminister Christian Lindner nur um Verbindlichkeit zu gehen, ohne anzuerkennen, dass es überhaupt einen Konflikt gibt. Weil er befürchtet, dass die Höhe der Staatsverschuldung zu einem „Gegenstand politischer Verhandlungen“ wird, fordert er eine bessere Durchsetzung durch eine einheitliche Regelung, um „jedes Jahr einen ausreichenden Schuldenabbau“ zu gewährleisten.
Gemeinsame finanzpolitische Regeln müssen einen raschen und ausreichenden Abbau von Defiziten und hohen Schuldenquoten gewährleisten und gleichzeitig die notwendigen öffentlichen und privaten Investitionen ermöglichen. Die Verbesserung der Qualität der öffentlichen Finanzen durch Prioritätensetzung bei den Ausgaben ist nach wie vor entscheidend. Um diesen Zielen gerecht zu werden, müssen die erstmals im Vertrag von Maastricht festgelegten Referenzwerte von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Defizitquote und 60 Prozent des BIP für die Schuldenquote unangetastet bleiben. Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit im Falle eines Verstoßes gegen das 3-Prozent-Defizitkriterium war in der Vergangenheit unser wirksamstes Durchsetzungsinstrument. Daran darf sich nichts ändern. […]
Darüber hinaus sind Schutzbestimmungen erforderlich, die sicherstellen, dass die Schuldenquoten, die die Maastricht-Referenzwerte überschreiten, in jedem Jahr tatsächlich zurückgehen. Wir brauchen auch weitere Maßnahmen, um die Einhaltung durch die Mitgliedstaaten zu gewährleisten, sowie weniger Ermessensspielraum bei der Auslegung und Anwendung der Regeln.
Nimmt man diese Formulierung ernst, so scheint der Vorschlag die Probleme einer prozyklischen Finanzpolitik und politischer Zwänge zu ignorieren, worauf Sander Tordoir hindeutete.
Budget policy is at the heart of democracy: you cannot wish politics away. Wolfgang Schäuble, the former German fin minister who was also a staunch proponent of tight fiscal policy, backed out of sanctioning Spain and Portugal in 2016 because he worried about political stability
— Sander Tordoir (@SanderTordoir) April 25, 2023
Wie Olivier Blanchard und Jeromin Zettelmeyer in einem kürzlich erschienenen Bericht schreiben, geht der deutsche Vorschlag zudem auf das Hauptproblem des Kommissionsvorschlags ein: Transparenz und gemeinsame Regeln für den Rahmen der Schuldentragfähigkeitsanalyse (DSA). Während Deutschland DSAs als ein Tier zu betrachten scheint, das nicht gezähmt werden kann und daher in einem Käfig gehalten werden muss“, betonen Blanchard und Zettelmeyer die Stärke von DSAs, um Schuldenrisiken und Anpassungsbedarf zu identifizieren“. Sie schlagen daher transparente Regeln für den Rahmen vor, um die Bestie zu zähmen:
Aber DSAs beißen nicht, und sie können sicherlich gezähmt werden. Anstatt zu einfachen numerischen Regeln zurückzukehren, sollten sich die deutsche Regierung – und die Kommission – darauf konzentrieren, die Schlussfolgerung des Rates umzusetzen, dass „der Zielpfad der Kommission auf einer zu vereinbarenden gemeinsamen Methodik beruhen sollte, die replizierbar, vorhersehbar und transparent ist und eine Analyse der öffentlichen Verschuldung und der wirtschaftlichen Herausforderungen umfassen sollte.
In seinem Artikel scheint Linder mit einem Ende der Reform zu drohen:
Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts kann kein Selbstzweck sein. Sie ist nur akzeptabel, wenn wir den Rahmen deutlich verbessern. Andernfalls wäre es nicht ratsam, die Regeln zu ändern.
Wie Blanchard und Zettelmeyer argumentieren, wäre dies „gefährlich für die Zukunft und ein schwerer Schlag für den Aufbau der EU, der um jeden Preis vermieden werden muss“.
Fünf Vorschläge für anwendbare EU Fiskalregeln – Policy Brief
Sander Tordoir , Jasper van Dijk, Vinzenz Ziesemer, CER, 17.04.2023
Die EU Fiskalregeln sind dringend zu reformieren. Sie sind zu kompliziert, verlangen von einigen Ländern unrealistische Anpassungen und fördern prozyklische Finanzpolitik. Mitgliederstaaten haben sich nur in etwa der Hälfte der Fälle an die Regeln gehalten.
CDU bereitet radikale Steuerwende vor – Artikel (Paywall)
Manfred Schäfers, FAZ, 17.04.2023
Topverdiener sollen mehr zahlen, damit die Mittelschicht profitiert. Auch eine echte Neuregelung bei der Erbschaftsteuer sehen die Steuer-Pläne der CDU vor.
Wo sind die Gewerkschaften? – Artikel
Rana Foroohar, Financial Times, 17.04.2023
Bidens Inflation Reduction Act bietet eine Chance auf Zusammenarbeit der Arbeitnehmerseite auf beiden Seiten des Atlantiks.
Expertenrat sieht Klimaziele 2022 nur teilweise erreicht und ordnet die geplante Novelle des Klimaschutzgesetzes ein – Pressemitteilung
Expertenrat für Klimafragen, 17.04.2023
Der Expertenrat für Klimafragen hat heute seinen Prüfbericht zu den Emissionsdaten 2022 vorgelegt. In dem gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) jährlich erstellten Bericht prüft und bewertet der Expertenrat die vom Umweltbundesamt nach sieben Sektoren gegliederte Berechnung der Vorjahres-Treibhausgasemissionen. Neben der Prüfung legt der Expertenrat vertiefend die Emissionsentwicklung einzelner Sektoren dar und nimmt eine Einordnung der Eckpunkte des Koalitionsausschusses vom 28. März zur Novelle des Klimaschutzgesetzes vor.
Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen – Artikel
Laurent Grandguillaume & Niels Planel, Social Europe, 17.04.2023
Soziale Unternehmen können Langzeitarbeitslosen einen Ausweg aus dem Teufelskreis der Inaktivität bieten, wie Frankreich zeigt.
Marcel Fratzscher zur deutschen Industriepolitik: „Ich halte das für einen Irrweg“ – Interview (Paywall)
Julian Olk, Handelsblatt, 13.04.2023
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung geht mit der Bundesregierung hart ins Gericht. Er warnt vor fatalen Folgen der geplanten Rückkehr der Industriepolitik.
Illusionen der Deregulierung – Artikel
Uwe Fuhrmann, Phenomenal World, 12.04.2023
Der Mythos von Deutschlands „Sozialer Marktwirtschaft“.
Korrigiert sich die Ökonomik selbst? – Artikel
Robert Kuttner, The American Prospect, 07.04.2023
Es gibt mehr Ökonom*innen, die sinnvolle und realitätsnahe Arbeit machen. Aber je höher es auf die Spitze der Profession geht, desto weniger hat sich verändert.
Obwohl so manche Marktfundamentalisten gerne die Rolle des Wettbewerbs betonen, neigt der Kapitalismus dazu, Monopole hervorzubringen. Wie ein neuer Report des Global Justice Netzwerkes zeigt, dominieren riesige Konzerne mit enormer Macht die globale Wirtschaft, indem sie Gesetze und Steuern umgehen und Einfluss auf Regierungen ausüben.
Im Jahr 2021 überstieg das kombinierte Einkommen der Top 500 Unternehmen weltweit 3 Billionen US-Dollar, was fast 40% der gesamten Weltwirtschaft entspricht. Die Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen weniger Unternehmen führt zu Ungleichheit, hemmt Innovationen und untergräbt die Demokratie. Die Regeln der globalen Wirtschaft, oft von den Unternehmen selbst entworfen, perpetuieren diesen Kreislauf von Unternehmensmacht und Reichtumsakkumulation. Monopolistischer Kapitalismus treibt nicht nur höhere Preise voran, sondern verschiebt auch die Macht weg vom öffentlichen Interesse und erschwert die Bemühungen zur Bewältigung dringender Herausforderungen wie dem Klimawandel. Es ist entscheidend, die Unternehmensmacht zurückzugewinnen, zu brechen, zu dezentralisieren und zu verteilen, um demokratische Entscheidungen zu treffen, die der Mehrheit zugutekommen und eine gerechte globale Wirtschaft fördern.
Den ganzen Bericht Monopolkapitalismus gibt es hier.