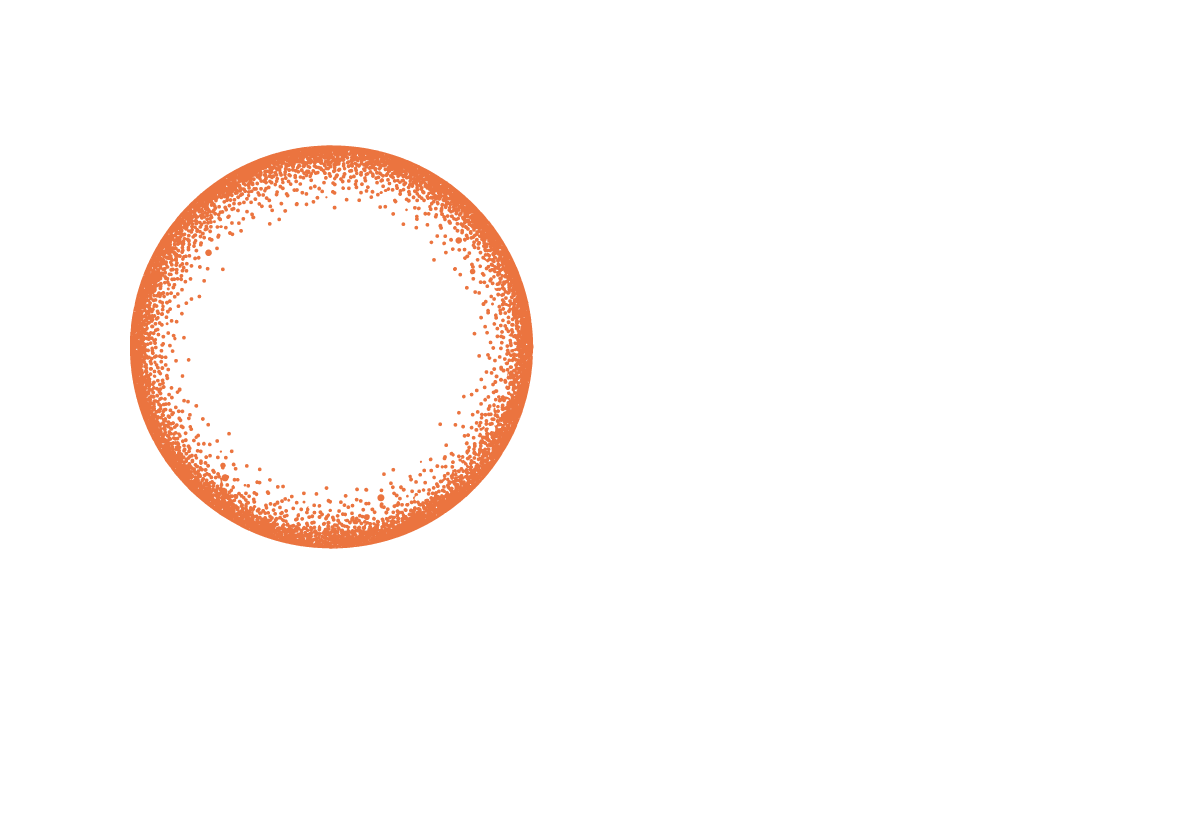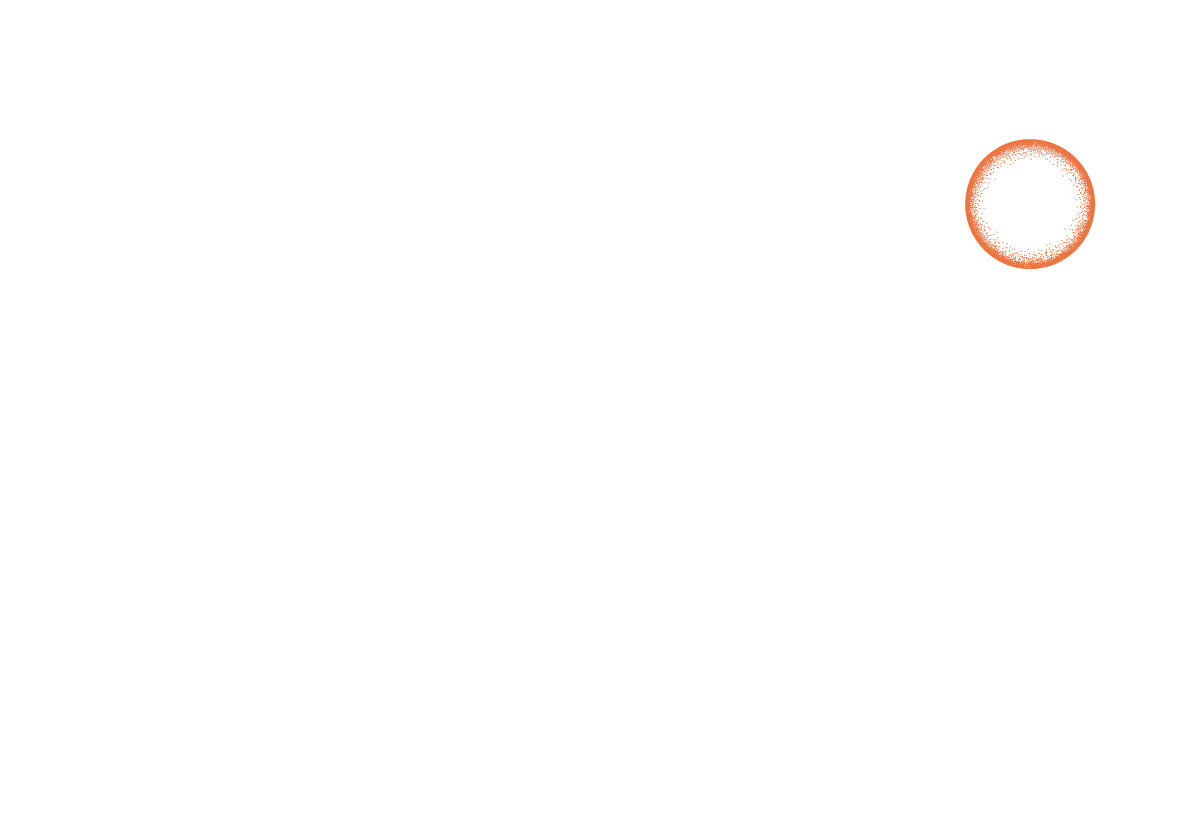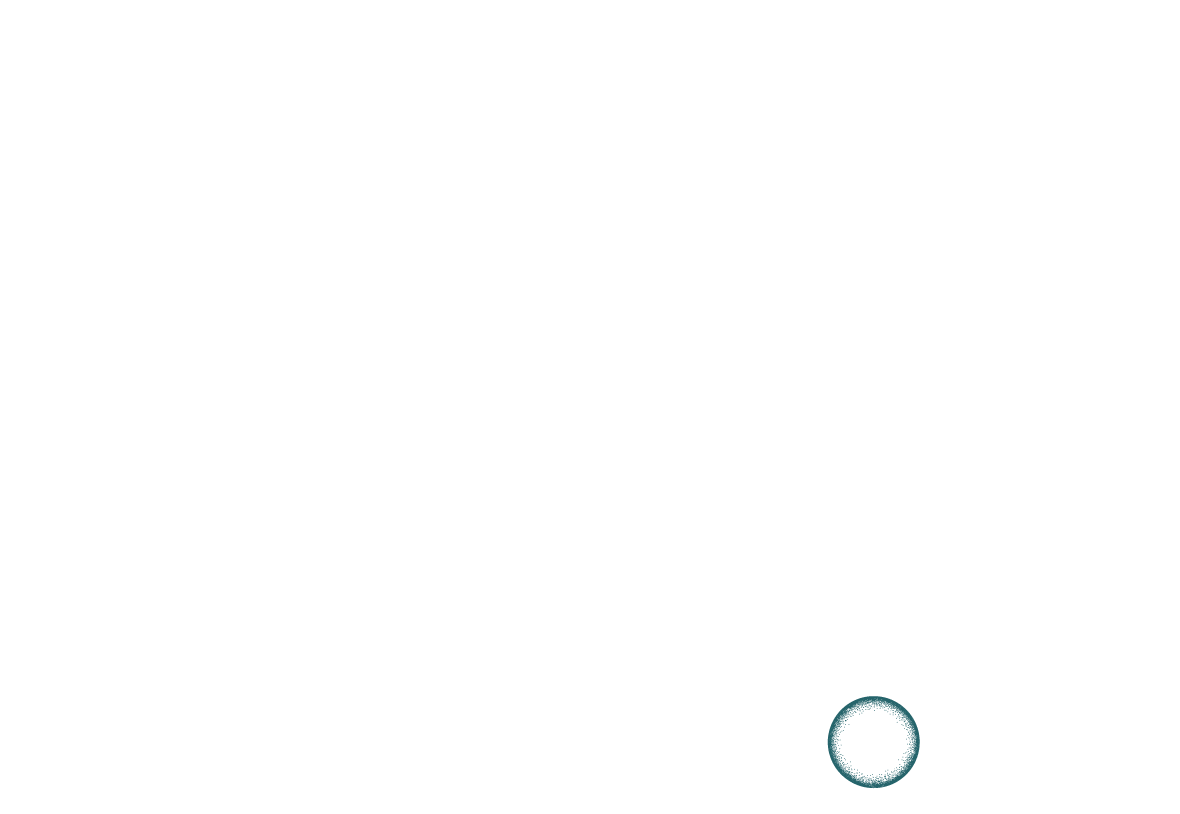Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Unsere Schuld(en) gegenüber künftigen Generationen – Artikel
Jo Stiglitz, Project Syndicate, 14.06.23
Niemand behauptet, dass die politischen Entscheidungsträger nicht an die künftigen Generationen denken sollten. Aber wir sollten uns nicht nur auf die Finanzverschuldung konzentrieren, sondern auch darüber nachdenken, welche Art von Welt wir unseren Nachkommen hinterlassen und welche aktuellen politischen und steuerlichen Verpflichtungen ihren Interessen besser dienen werden.
Die Ineffizienz des Wachstums bei der Armutsbekämpfung – Artikel
Arthur Zito Guerriero, Makronom, 12.06.23
Die globale Armut ist seit der Jahrtausendwende stark zurückgegangen – was aber hohe Wachstumsraten erforderte und großen Umweltbelastungen mit sich brachte. Und nur ein minimaler Anteil der neugenerierten Wirtschaftsleistung kam tatsächlich den Armen zugute, während vor allem die reichen Einkommensgruppen profitierten.
Höherer Steuersatz nur für Millionäre – Mit dieser Idee will die Union wieder regieren – Artikel
Karsten Seibel, die Welt, 10.06.23
Die CDU will Bezieher von Einkommen bis etwas mehr als eine Million Euro entlasten. Als Blaupause dienen ihr aktuelle Berechnungen des Steuerzahlerbundes. Jetzt müssen sich nur noch potenzielle Koalitionspartner darauf einlassen.
Der Silberstreif der nationalen Souveränität – Artikel
Dani Rodrik, Project Syndicate, 09.06.23
Trotz der düsteren Vorhersagen, die den Niedergang der Global Governance begleitet haben, bedeutet weniger internationale Zusammenarbeit nicht unbedingt eine Katastrophe. Vielmehr können nationale Regierungen dem Wohlstand im eigenen Land und dem sozialen Zusammenhalt Vorrang vor dem Multilateralismus einräumen, ohne der Weltwirtschaft zu schaden.
Die Wirtschaft und Banken brauchen die Natur zum Überleben – Blogbeitrag
Frank Elderson, ECB, 08.06.23
Der Mensch braucht die Natur zum Überleben, ebenso wie die Wirtschaft und die Banken. Je mehr Arten aussterben, desto weniger vielfältig sind die Ökosysteme, auf die wir angewiesen sind. Dies stellt ein wachsendes finanzielles Risiko dar, das nicht ignoriert werden kann, warnt Frank Elderson, Mitglied des Direktoriums der EZB und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der EZB.
Aufschläge, Gewinnanteile und Cost-Push gewinngetriebene Inflation – Artikel
Michalis Nikiforos & Simon Grothe, INET, 06.06.23
Inwieweit ist eine gewinngetriebene Inflation mit dem vereinbar, was wir über das Preissetzungsverhalten von Unternehmen und die Einkommensverteilung wissen?
Gender Pay Gap – Von der Rolle – Volltext
Helena Ott, ze.tt, 08.06.23
Nach der Geburt eines Kindes hängen viele Frauen in Minijobs fest und bleiben so abhängig von ihren Partnern. Und der Staat? Tut viel dafür, dass es so bleibt.
16 Gründe für schnelles Handeln – Kipppunkte und ihre Bedeutung für die Klimapolitik – Volltext
Vera Huwe, Levi Henze, Janek Steitz, Dezernat Zukunft, 07.06.23
Ein neues Hintergrundpapier beschäftigt sich mit Kippelementen im Erdsystem und den damit einhergehenden Mechanismen und Risiken. Die klimawissenschaftliche Forschung zu Kippelementen hat kürzlich große Erkenntnisfortschritte erzielt, die weitreichende Implikationen für die Klimapolitik aufweisen, von der breiten Öffentlichkeit aber weitgehend unbemerkt geblieben sind.
Rückbesinnung auf die Verhaltensrevolution in der Ökonomie – Artikel
Antara Haldar, Project Syndicate, 02.06.2023
In den letzten 15 Jahren haben die Wirtschaftswissenschaften mit der zunehmenden Anerkennung der Verhaltenswissenschaften nach und nach die Bedeutung der Vorurteile anerkannt, die Einzelpersonen und Unternehmen zu irrationalem Verhalten veranlassen. Die dringend benötigte erkenntnistheoretische Revolution ist jedoch ausgeblieben, da sich die Wirtschaftswissenschaftler gegen Veränderungen sträuben.
Eine Linderung für Zukunftssorgen – Kolumne
Marcel Fratzscher, Die Zeit, 02.06.2023
Die Mehrheit der Deutschen spricht sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus, bevorzugt ein Modell mit 1.200 Euro monatlich. Und vor allem aus Angst vor dem Wandel.
Mit künstlicher Intelligenz gegen künstliche Intelligenz – Artikel (Paywall)
Roland Preuß, Süddeutsche Zeitung, 05.06.2023
KI ändert den Arbeitsalltag von Millionen Beschäftigten. Kann die Politik Schritt halten? Im Arbeitsministerium von Hubertus Heil versuchen sie es – auch mithilfe der neuen Technik.
Wissenschaftler sagen, dass die Erde ihre Grenzen für den Menschen überschritten hat – Artikel
Attracta Moorey, Financial Times, 31.05.2023
Forschungsergebnissen zufolge haben die Aktivitäten 7 von 8 Planetengrenzen in Risikozonen verschoben.
Wirtschaft grundlegend neu denken (lernen) – Blogbeitrag
Lukas Bäuerle, Makronom, 01.06.2023
Viele Studierende nehmen ihre wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungsprogramme als realitätsfremd wahr. Eine Lehrreform ist überfällig – und sollte sich an bestimmten Grundsätzen orientieren.
Krise der Demokratie – wo lernen wir noch, uns einzumischen? – Podcast
Petra Pinzler & Stefan Schmitt, Die Zeit, 31.05.2023
In Städten und Gemeinden mangelt es an Menschen, die sich engagieren. Wie lässt sich Demokratie konkret fördern? Das fragen wir Elisabeth Niejahr von der Hertie-Stiftung.
(Keine) Angst vorm Sensenmann? – Blogbeitrag
Moritz Gartiser, Makronom, 08.05.2023
Ein maßgeblicher Treiber der Ungleichheit in Deutschland ist der Rückgang der Besteuerung hoher Vermögen. Eine Analyse der Medienberichterstattung zur Erbschaftsteuer gibt nun Hinweise dafür, wie Steuersenkungen öffentlich kommentiert und legitimiert werden.
Wie der Paradigmenwechsel in der US-Wirtschaftspolitik durch Isabella Weber und ihre Ideen zur Inflation verkörpert wird ist Thema eines kürzlich erschienenen New Yorker Artikels.
Diese verblüffende Kehrtwende offenbart einen Wandel in der Art und Weise, wie wir die Weltwirtschaft konzeptualisieren. Wenn man Webers einst verbotene Theorien versteht, kann man nachvollziehen, wie dramatisch sich die wirtschaftlichen Annahmen Washingtons in den letzten zwei Jahren verändert haben – und was dieses neue Denken für die Zukunft des Landes bedeuten könnte… Auf Joe Bidens erster Pressekonferenz als Präsident stellte er seinen 1,9-Billionen-Dollar-Rettungsplan vor, indem er ankündigte, er wolle einen „Paradigmenwechsel“ im wirtschaftlichen Denken vollziehen.
Den ganzen Artikel gibt es hier.
‚Degrowth‘ beginnt, von Europas politischen Rändern aus Einzug zu halten – Artikel
Martin Sandbu, Financial Times, 30.05.2023
Unorthodoxe wirtschaftliche Ideen finden im Zuge des Klimawandels ein breites Publikum.
Ohne sichere Staatsanleihen wird die Eurozone nicht funktionieren – Artikel
Fabian Lindner, Social Europe, 30.05.2023
Das obskure Konzept der „monetären Dominanz“ stand hinter der letzten Krise der Eurozone. Wenn sie nicht hinterfragt wird, könnte sie einer weiteren Krise zugrunde liegen.
Was kostet die Welt? 630 Billionen Dollar – Artikel
Henrik Müller, Der Spiegel, 28.05.2023
Eine neue Studie rechnet vor, wie viel das Anlagevermögen rund um den Globus wert ist. Binnen zwei Jahrzehnten hat sich die Summe vervierfacht. Das stellt grundlegende Fragen an unser Wirtschaftssystem.
Der Defizit-Mythos hält sich hartnäckig – Blogpost
Stephanie Kelton, Substack, 30.05.2023
Das alte Spielbuch feiert ein Comeback. Demokraten und Republikaner nähern sich mit dem „Fiscal Responsibility Act“ einer Einigung über eine „Schuldengrenze“.
Die unsoziale Rezession – Kolumne
Marcel Fratzscher, Die Zeit, 26.05.2023
Die Wirtschaft ist in die Rezession gerutscht. Das trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen hart. Gerade für sie ist auf Jahre keine Erholung absehbar.
IIPP soll einen Index der Fähigkeiten des öffentlichen Sektors erstellen – Presseerklärung
26.05.2023
Das UCL IIPP hat mit Unterstützung von Bloomberg Philanthropies eine neue Forschungsinitiative gestartet, um einen Index der Fähigkeiten des öffentlichen Sektors zu erstellen – die erste globale Messung der Fähigkeit von Regierungen, Probleme zu lösen.
Stolz und Fehlurteil – Artikel (Paywall)
Sebastian Thieme, FAZ, 23.05.2023
Die Volkswirtschaftslehre verweigert sich dem Dialog mit der Pluralen Ökonomie. Dabei kann diese ihre Kritik an dem Fach längst belegen.
Ein Zielkonflikt bringt mit sich, dass nicht alle Wünsche gleichzeitig umgesetzt werden können. Es muss Abstriche und Kompromisse geben, es muss priorisiert werden. Wie Jean Pisani-Ferry in einem kürzlich erschienenen Artikel schreibt, scheint die Europäische Union einem offensichtlichen Zielkonflikt zwischen Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und Schuldenregeln momentan aus dem Weg zu gehen.
Am umsichtigsten wäre es, wenn der Euro-Raum die fiskalischen Zwänge durch eine grüne Ausnahmeregelung oder ein gemeinsames Verschuldungsprogramm lockern würde, das durch eine Vereinbarung über die Aufstockung seiner Eigenmittel gestützt wird. Zugegebenermaßen würde ein solcher Schritt das Risiko einer makroökonomischen Instabilität mit sich bringen. Aber er wäre weniger schädlich als ein Verzicht auf Wettbewerbsfähigkeit oder ein Zerfall des multilateralen Systems. Das Beharren auf fiskalischer Korrektheit könnte die EU mit erheblichen Verlusten an anderen Fronten konfrontieren. Im Gegensatz zu dem, was einige europäische Politiker glauben mögen, wird der Übergang zu sauberer Energie nicht ohne Kosten sein. Die Entscheidung, vor der die europäischen Politiker stehen, ist einfach: Jetzt handeln, um diese Kosten zu bewältigen, oder später einen viel höheren Preis zahlen.
Den ganzen Artikel gibt es hier.