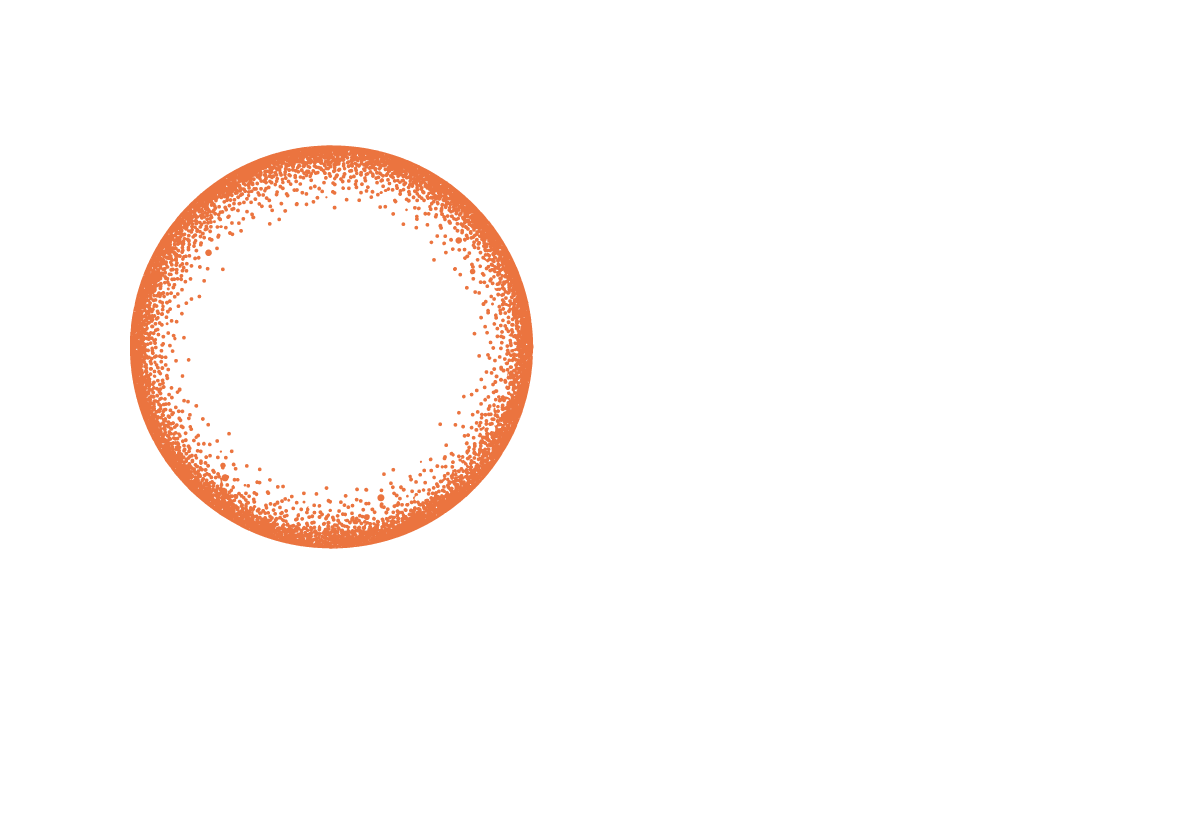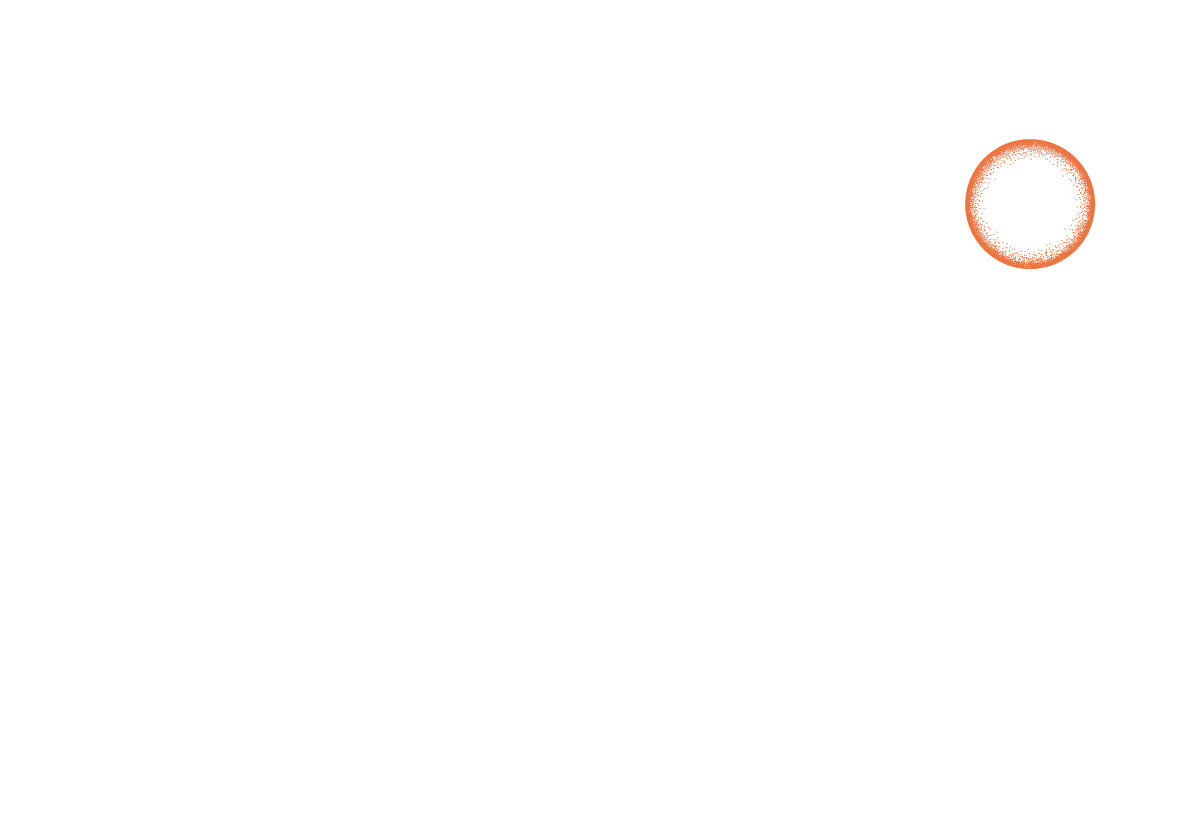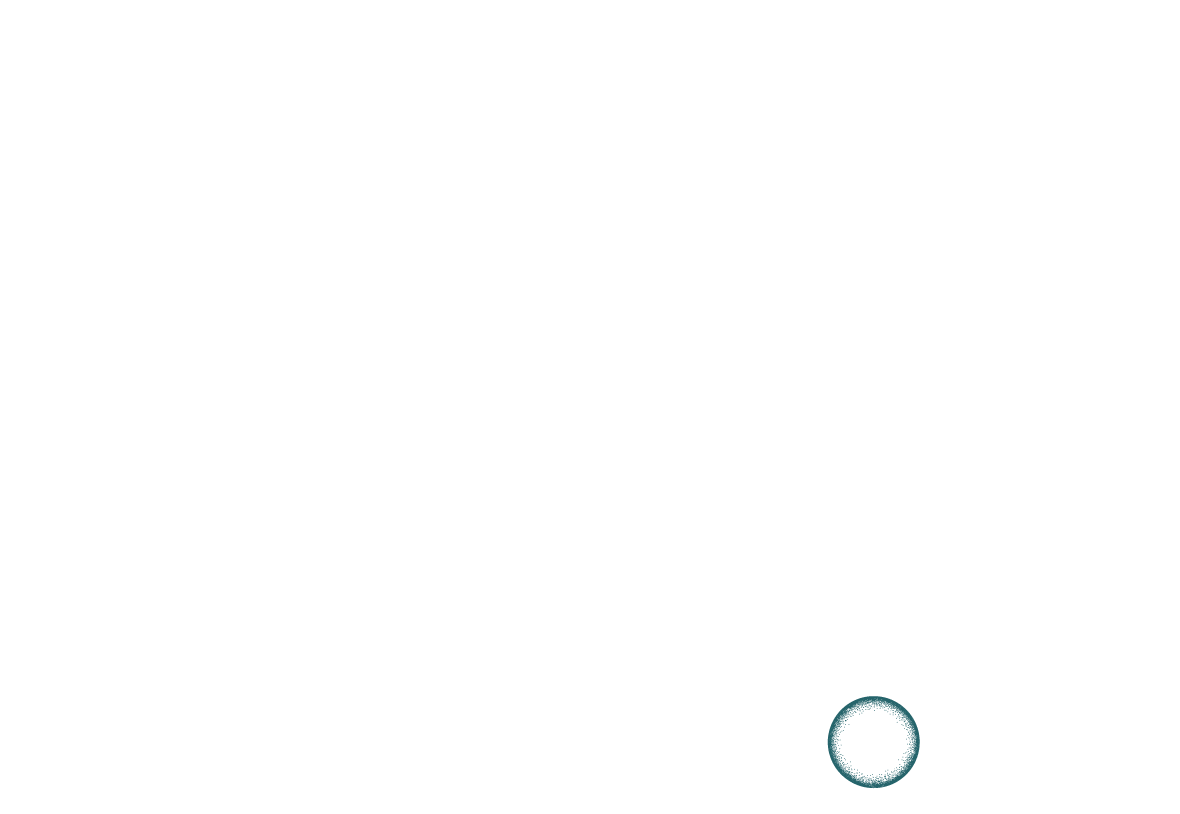Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Macht Staatsgeld glücklich? – Artikel
Mark Schieritz & Petra Pinzler, die Zeit, 19.07.2023
Muss der Staat Milliarden in die Wirtschaft kippen, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt – und sicher vor politischen Turbulenzen? Ja, sagt die grüne Staatssekretärin Franziska Brantner. Der Ökonom Stefan Kolev hält das für einen Irrweg.
Der US-Verbraucherschutz geht Präsident Joe Biden nicht weit genug. Bei einem Auftritt wetterte er gegen unfaire Firmenfusionen – und den Mietmarkt: »Die Leute sind es leid, für dumm verkauft zu werden.«
Was, wenn die EU rechts wird? – Artikel
Mark Schieritz, die Zeit, 20.07.2023
Die EU gilt als liberales Projekt. Nun könnten nationalistische Kräfte die Macht in Brüssel übernehmen und die EU nach den eigenen Vorstellungen umbauen.
Nein, ihr gehört nicht zur Mittelschicht – Artikel
Nils Wischmeyer, Süddeutsche Zeitung, 15.07.2023
Menschen zählen sich zur Mitte der Gesellschaft, obwohl sie Topverdiener sind oder arm. Das führt zu falschen politischen Entscheidungen. Es gibt nur einen Ausweg: Gehaltszettel auf den Tisch.
Vor allem Union und FDP reden gern von Leistung und Leistungsfähigkeit. Beim Umbau des Steuersystems in diese Richtung verdrücken sie sich aber lieber.
Vollzeitarbeit ist keine Lösung – Artikel
Jutta Allmendinger, Die Zeit, 19.07.2023
Endlich werde über Armut, Familien und Fürsorge gestritten, schreibt die Soziologin Jutta Allmendinger. Das sind ihre Vorschläge für eine moderne Familienpolitik.
Elf Thesen zur Globalisierung – Artikel
Branko Milanovic, Substack, 18.07.2023
In letzter Zeit wurde viel über die Globalisierung und ihre Auswirkungen, insbesondere auf Armut und Ungleichheit, diskutiert, und es wurden viele widersprüchliche, teilweise sogar absurde Aussagen gemacht. Hier sind elf Thesen zur Globalisierung.
Taking Aim at Sellers’ Inflation – Artikel
Isabella M. Weber, Project Syndicate, 13.07.2023
WirtschaftswissenschaftlerInnen und PolitikerInnen in multilateralen und europäischen Institutionen haben endlich akzeptiert, dass die Unternehmensgewinne heute eine der Hauptursachen für die Inflation sind. Doch die richtige Analyse ist nur der erste Schritt; jetzt brauchen wir eine grundlegende Änderung der Art und Weise, wie wir das Problem angehen.
Brüssels Wirtschaftschef sagt, dass die EU Milliarden von Euro in kritische Industrien pumpen muss, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.
Die Vereinigten Staaten erleben einen Investitionsboom, der auf industriepolitische Maßnahmen zurückzuführen ist, die enorme Subventionen – auch für europäische Unternehmen – für Investitionen in Amerika, vor allem im Bereich der grünen Technologien, gewähren. Europa reagiert unterdessen mit einer Rückkehr zur Sparpolitik, die es überhaupt erst hinter die USA zurückfallen ließ.
In den 1980er Jahren initiierte Ronald Reagan eine Wirtschaftspolitik, die auf der ganzen Welt Nachahmung fand und als „Reaganomics“ bekannt wurde. Nun führt Joe Biden mit „Bidenomics“ einen neuen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik ein. So argumentiert Max Krahé in einem jüngst erschienenen Beitrag für den Blog Politik&Ökonomie. Und er ist damit nicht allein: die Financial Times spricht von einer »revolution in economic policy«. Und auch zahlreiche deutsche Medien berichten staunend über die wirtschaftspolitische Wende aus Washington.
Doch was hat diesen Wandel angestoßen und was genau verbirgt sich hinter „Bidenomics“? Und wie sehen die vorläufigen Ergebnisse der zahlreichen Maßnahmen aus? Dem geht Krahé in seinem Beitrag nach.
Die Quintessenz: das Scheitern des vorherigen, marktliberalen Paradigmas lies keine andere Wahl als eine wirtschaftspolitische Neuausrichtung (und das sagt nicht Krahé, sondern Jake Sullivan, Joe Bidens nationaler Sicherheitsberater). Es erodierte die amerikanische industrielle Basis, destabilisierte die Demokratie und blieb Antworten auf die Klimakrise schuldig. Auch die neue geopolitische Situation spielt eine Rolle.
Den Kern von Bidenomics bilden drei Gesetze: IRA, CHIPS, und das Infrastrukturgesetz. Aber was haben sie gebracht? Krahé attestiert den Programmen „viel Licht und ein bisschen Schatten“ – so sei das Investitionslevel trotz hoher Zinsen stark gestiegen, der vor-Corona-Wachstumspfad sei wieder erreicht, und höhere Emissionsreduktionen realistisch. Gleichzeitig bestehe die Gefahr dass einzelne Branchen übersubventioniert würden – ein finanzielles Fass ohne Boden.
Den ganzen Kommentar gibt es hier zu lesen.
Fokus auf Produktivität, nicht auf Technologie – Artikel
Dani Rodrik, Project Syndicate, 07.07.2023
Wissenschaftliche und technologische Innovationen sind zwar notwendig für ein Produktivitätswachstum, das die Gesellschaften bereichert, aber sie sind nicht ausreichend. Ohne die richtigen flankierenden politischen Maßnahmen kann der technologische Fortschritt nicht zu einer dauerhaften Verbesserung des Lebensstandards führen und in einigen Fällen ein Land sogar zurückwerfen.
Wer ist hier reich? – Artikel
Franz Kotteder, Süddeutsche Zeitung, 10.07.23
Deutschland verliert seine Mittelschicht. Das ist kein Grund zur Häme. Die Debatte ums Elterngeld zeigt: Wir brauchen eine neue Solidarität.
Der Haushalt schwächt Deutschlands Wohlstand – Artikel
Marcel Fratzscher, die Zeit, 07.07.23
Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Schuldenbremse einhalten, mehr Investitionen, aber keine Steuererhöhungen. So erreicht er nichts davon.
Außer die Dinge noch schlimmer zu machen, nachdem sie von selbst verschwunden ist.
Die Vereinigten Staaten verändern die Spielregeln der Weltwirtschaft, sagt der Historiker Adam Tooze. Sicherheit werde wichtiger als Wohlstand. Deutschland müsse sich anpassen und mehr Geld ausgeben.
Debattenmonitor Fachkräftemangel – Artikel
Susanne Erbe, Makronom, 03.07.2023
In einer Makronom-Serie haben Forscherinnen und Forscher die diversen Aspekte des Fachkräftemangels aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ein neuer Debattenmonitor bündelt diese und weitere Erkenntnisse zu einem der größten Probleme der deutschen Wirtschaftspolitik.
Dieses Ziel sollte einer öffentlichen Prüfung unterzogen und an den aktuellen Erfordernissen gemessen werden.
„Die CDU muss sozialer auftreten“ – Artikel
Robert Roßmann, Süddeutsche Zeitung, 11.07.23
Der Arbeitnehmerflügel kritisiert, die Parteispitze vernachlässige soziale Themen – das schade auch in der Auseinandersetzung mit der AfD. Doch jetzt macht Friedrich Merz ausgerechnet Carsten Linnemann zum Generalsekretär.
Ampel gibt dem Kartellamt einschneidende Befugnisse – Artikel (Bezahlschranke)
Julian Olk, Handelsblatt, 03.07.2023
Deutschland bekommt die größte Wettbewerbsreform seit Jahrzehnten. Das Kartellamt kann sich marktbeherrschende Firmen viel früher vorknöpfen.
Florian Diekmann, der Spiegel, 04.07.2023
Die AfD ist besonders erfolgreich bei Arbeitern und Gewerkschaftern. Hier spricht der Jenaer Soziologe Klaus Dörre darüber, was die rechte Partei für diese Menschen attraktiv macht – und welche Strategie helfen könnte.
Die Energiekrise hat die deutsche Wirtschaft schwer getroffen – Artikel (Bezahlschranke)
Tom Krebs, Handelsblatt, 01.07.2023
Vier Prozent weniger Bruttoinlandsprodukt und rekordhohe Kaufkraftverluste widersprechen für Tom Krebs der Einschätzung, wir hätten die Krise gut überstanden.
Erfolgreiche Rebellen – Artikel
Patrick Bernau & Alexander Wulfers, FAZ, 28.06.2023
Wenn andere Wissenschaftler von der Mehrheitsmeinung abweichen, werden sie oft geächtet. Ökonomen bekommen dann erst recht Einfluss.
Adam Smith zum 300. Geburtstag – Artikel (Englisch)
Diane Coyle, Project Syndicate, 23.06.2023
Der dreihundertste Jahrestag von Adam Smiths Geburt ist eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie seine Erkenntnisse über die Dynamik des Wirtschaftswachstums unser heutiges Weltbild prägen. Was aber, wenn die Arbeitsteilung, auf der Smiths Wachstumstheorie beruhte, an ihre Grenzen stößt?
Wie die Reichen unantastbar wurden – Artikel (Bezahlschranke)
Lenz Jacobsen, die Zeit, 02.07.2023
Die Vermögensungleichheit wird zunehmend obszöner, aber politisch scheint das kaum noch jemanden zu interessieren. Warum eigentlich?
„1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr erforderlich“ – Artikel
Gegen den Fachkräftemangel schlägt die Wirtschaftsweise Schnitzer mehr Zuwanderung vor. Das neue Fachkräftegesetz gehe schon in die richtige Richtung, aber die Bundesrepublik komme insgesamt nicht so voran, „wie wir könnten und müssten“.
Haushaltsnot gefährdet Lindners Investitionsanreize für Unternehmen – Artikel (Bezahlschranke)
Martin Greive & Jan Hildebrand, Handelsblatt, 29.06.2023
Finanzminister Lindner will mit Superabschreibungen die Investitionen der Unternehmen ankurbeln. Aufgrund der schlechten Haushaltslage dürfte das Vorhaben nun kleiner ausfallen.
Wie lässt sich dem Fachkräftemangel eindämmen? In einem kürzlich erschienenen Interview mit dem Makronom spricht IZA-Direktor Simon Jäger über as Ausmaß des Mangels und mögliche Gegenmaßnahmen. Warum der Markt, der bei knappem Angebot die Löhne deutlich ansteigen lassen sollte, nicht immer alles regelt?
Ich denke, dass die Erkenntnisse aus der modernen Arbeitsmarktforschung zur Marktmacht von Unternehmen am Arbeitsmarkt eine entscheidende Rolle beim Verständnis spielen. Der Arbeitsmarkt ist kein perfekt kompetitiver Markt und die Friktionen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Klage über Arbeitskräftemangel ist auch Ausweis dessen, dass in manchen Bereichen Löhne unterhalb der Arbeitsproduktivität gezahlt werden.
Um dem Problem zu begegnen, sind beispielsweise bessere Einwanderungsangebote ein wichtiger Pfeiler. Das IZA schlägt eine Kopplung von Einwanderung an Tarifbindung vor und verspricht sich davon eine doppelte Dividende: Steigerung der Erwerbsmigration zusammen mit zusätzlichem Anreiz für produktive, wachsende Unternehmen, eine Tarifbindung einzugehen.
Das ganze Interview gibt es hier zu lesen.