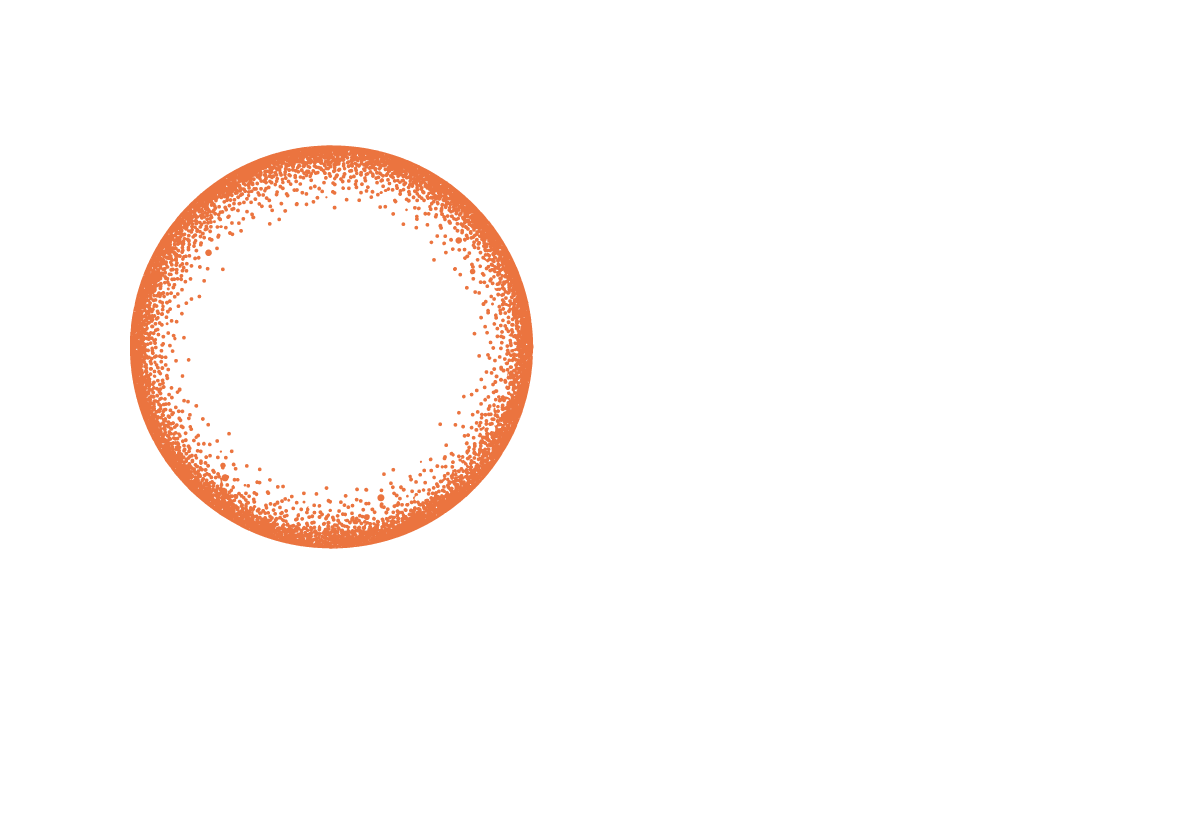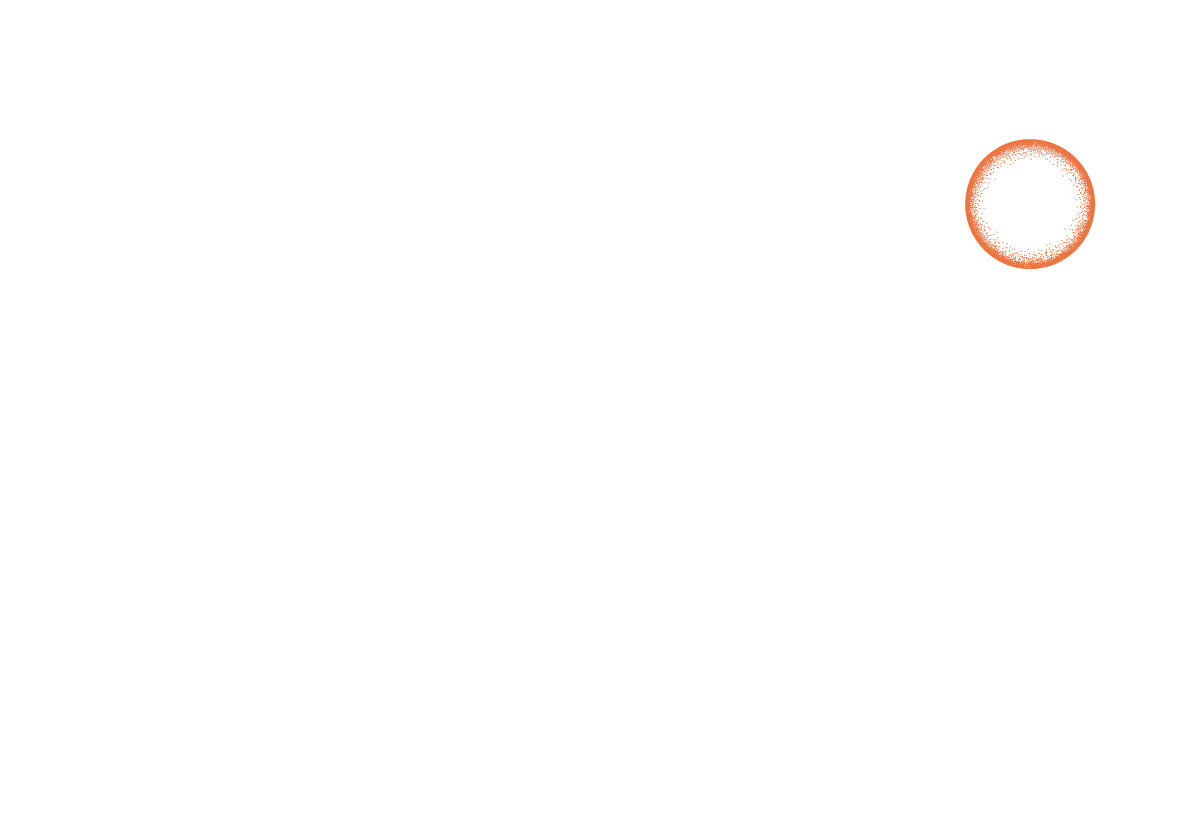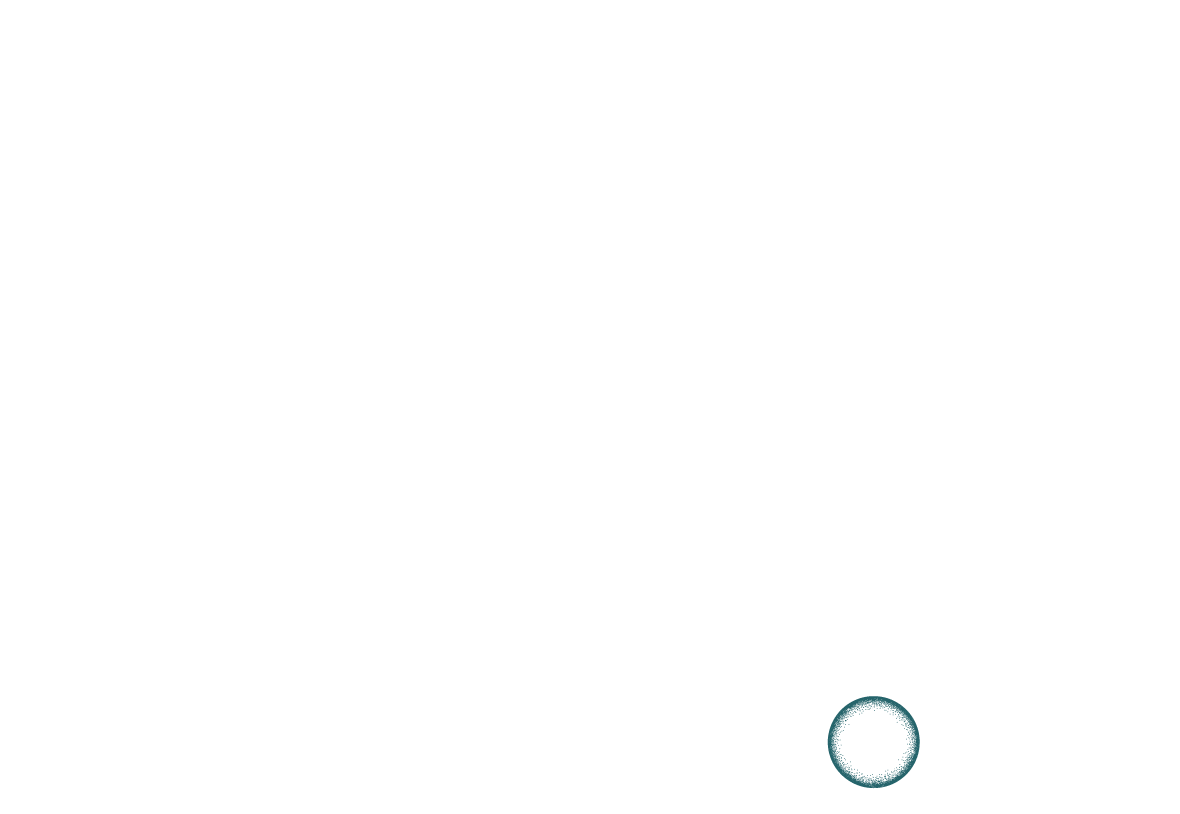Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Die 2010er Jahre waren das Jahrzehnt Deutschlands. Das Jobwunder, das in den 2000er Jahren begann, erreichte seine volle Blütezeit, weitgehend unbeeinflusst von der globalen Finanzkrise 2007-09, als die von Gerhard Schröder, Bundeskanzler von 1998 bis 2005, eingeführten Arbeitsmarktreformen in Verbindung mit Chinas Nachfrage nach Industriegütern und einem Boom in den Schwellenländern 7 Millionen neue Arbeitsplätze schufen. Von Mitte der 2000er bis Ende der 2010er Jahre wuchs die deutsche Wirtschaft um 24 %, verglichen mit 22 % in Großbritannien und 18 % in Frankreich. Angela Merkel, Bundeskanzlerin von 2005 bis 2021, wurde für ihre erwachsene Führung gelobt. Populismus in der Art von Trump und Brexit wurde als Problem für andere Länder angesehen. Deutschlands Sozialmodell, das auf engen Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern beruht, und sein kooperativer Föderalismus, der das Wachstum über das ganze Land verteilt, begeisterten die Kommentatoren, die Bücher mit Titeln wie „Warum die Deutschen es besser machen“ veröffentlichten. Die deutschen Fußballer gewannen sogar die Weltmeisterschaft.
Die 2020er Jahre werden ganz anders aussehen, und das nicht nur, weil die Fußballnationalmannschaft schwächelt. Die Alternative für Deutschland, eine rechtspopulistische Partei, liegt in den Umfragen bei 20 %. Die Deutschen sind mit ihrer Regierung unzufrieden. Besonders besorgniserregend ist, dass das gepriesene deutsche Wirtschaftsmodell und der deutsche Staat nicht in der Lage zu sein scheinen, das Wachstum und die öffentlichen Dienstleistungen zu bieten, die die Menschen erwarten.
Nach dem Jobwunder-Jahrzehnt ist die deutsche Wirtschaft laut IWF die einzige G7-Wirtschaft, die in diesem Jahr schrumpft. Dies hat einige Kommentatoren dazu veranlasst, die Diagnose von Anfang 2000 wieder auszugraben, wonach Deutschland der kranke Mann Europas sei. Ein kürzlich erschienener Artikel im Economist fasst die wichtigsten Herausforderungen zusammen, die Deutschlands Position vom europäischen Spitzenreiter zum Nachzügler machen: Geopolitik, Dekarbonisierung und Demografie.
Geopolitik
Die starke Abhängigkeit Deutschlands von China (Exporte des verarbeitenden Gewerbes) und Russland (Energieimporte) macht die deutsche Wirtschaft anfällig für geopolitische Veränderungen. Die langsame Erholung der asiatischen Wirtschaft nach der Pandemie und der Gaspreisschock des letzten Jahres beeinträchtigen die exportorientierte Wirtschaft. Pläne, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, werden durch die strengen Defizitgrenzen der Schuldenbremse eingeschränkt.
Dekarbonisierung
Einst ein Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien, ist Deutschland heute ein Klimaschlußlicht, denn sein „jährlicher Kohlendioxid-Fußabdruck ist mit 9 Tonnen pro Person etwa 50 % höher als der von Frankreich, Italien oder Spanien“.
Obwohl Deutschland eines der energieeffizientesten Länder Europas ist – was bedeutet, dass wenig Abfall anfällt – verbraucht es aufgrund seiner großen industriellen Basis enorme Mengen an Energie. Um diese Energie umweltfreundlicher zu machen, müssen schwierige Kompromisse eingegangen werden.
Demografie
Da die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen, haben die Unternehmen immer mehr Mühe, Mitarbeiter zu finden.
Ohne Zuwanderung oder mehr Frauen und ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt wird der Arbeitsmarkt bis 2035 7 Millionen seiner 45 Millionen Arbeitskräfte verlieren, rechnet Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarktforschung, einem Think-Tank, vor. Wie er anmerkt: „Die nackten Zahlen sind dramatisch“.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist ein leistungsfähiger und effizienter Staat erforderlich. Wie der Artikel feststellt, ist der deutsche Staat dies jedoch nicht, was eine vierte Herausforderung darstellt:
Das Problem liegt nicht in fehlenden Mitteln, sondern in der Art der Verwaltung selbst. Beobachter zeichnen das Bild einer Regierung, die mit Anwälten vollgestopft ist und nicht in der Lage ist, die Politik zu steuern oder auch nur die Berater angemessen zu überwachen.
Den vollständigen Artikel gibt es hier.
Sparen oder nicht sparen? – Artikel
Petra Pinzler, Die Zeit, 10.08.2023
Das ist hier die falsche Frage. Warum diskutieren wir immer noch so wirklichkeitsfremd – statt uns die Welt in Zeiten der Klimakrise mal neu anzuschauen?
Good Governance ist eine schlechte Idee – Artikel
Katharina Pistor, Project Syndicate, 09.08.2023
Die Good-Governance-Agenda war immer dazu gedacht, die zugrunde liegenden Machtstrukturen zu verschleiern, indem technokratische Entscheidungen über politische Kämpfe gestellt wurden. Die vollen Kosten sind erst vor kurzem deutlich geworden, da das Paradigma wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel blockiert.
Ökonomen überdenken Industriepolitik – Artikel
Dani Rodrik, Réka Juhász, Nathan Lane, Project Syndicate, 04.08.2023
In der Vergangenheit konzentrierten sich Ökonomen, die die Leistung industriepolitischer Maßnahmen bewerteten, häufig auf Indikatoren wie Importzölle, wobei sie nur begrenzte Dimensionen solcher Maßnahmen erfassten und ihre Ziele mit anderen vermengten. Eine neue Generation von Forschungsarbeiten verfolgt einen produktiveren Ansatz – und kommt zu ganz anderen Schlussfolgerungen.
Italien schockiert Banken mit einer 40-prozentigen Sondersteuer für 2023 – Artikel
Angelo Amante, Valentina Za and Giuseppe Fonte, Reuters, 08.08.2023
Italien hat seinen Banken einen überraschenden Schlag versetzt und den gesamten Sektor in Europa erschüttert, indem es eine einmalige Steuer von 40 % auf Gewinne aus höheren Zinssätzen festsetzte, nachdem es die Kreditinstitute dafür gerügt hatte, dass sie Einlagen nicht belohnt hatten.
Der Druck auf Lindner und die Schuldenbremse wächst – Artikel (Paywall)
Georg Ismar, Süddeutsche Zeitung, 06.08.2023
SPD-Politiker, Berlins Regierungschef und bekannte Ökonomen fordern, befristet mehr Schulden aufzunehmen – wegen der wirtschaftlichen Lage und der Wohnungsnot.
„Protestwähler-These war nie richtig“: Wer wählt die AfD? – Artikel
Max Kienast, Jasmin Brock, BR, 03.08.2023
Im ARD-DeutschlandTrend erreicht die AfD erneut Rekordwerte. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 21 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei der AfD machen. Wer gibt der Partei seine Stimme? Ein demografischer Überblick.
Fundamental global – Artikel (Paywall)
Sven Beckert, Die Zeit, 05.08.2023
Der Kapitalismus gilt als Erfindung Europas. Doch seine Geschichte beginnt genauso mit arabischen, afrikanischen, indischen, chinesischen Kaufleuten, Bauern und Geldverleihern.
Kann die Philosophie von John Rawls die liberale Demokratie retten? – Blogpost
Nick French, Cataylst Journal, 31.07.2023
Die Ideen von John Rawls, dem vielleicht größten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, haben der Linken viel zu lehren. Aber Rawls‘ Theorien haben es versäumt, sich angemessen mit den grundlegenden Hindernissen auseinanderzusetzen, die der Kapitalismus der Verwirklichung einer gerechten Gesellschaft entgegenstellt.
Die Welt wird in den nächsten zehn Jahren 4,7 Billionen Dollar an Steueroasen verlieren, wenn die UN-Steuerkonvention nicht angenommen wird, so die Warnung der Länder – Blogpost
TaxJustice Net, 25.07.2023
Das Tax Justice Network (Netzwerk für Steuergerechtigkeit) warnt davor, dass den Ländern in den nächsten zehn Jahren fast 5 Billionen US-Dollar an Steuern entgehen werden, weil multinationale Unternehmen und wohlhabende Einzelpersonen Steueroasen nutzen, um zu wenig Steuern zu zahlen.
So weit liegen Arm und Reich auseinander – Artikel (Paywall)
David Böcking & Holger Dambeck, Der Spiegel, 31.07.2023
Wer bekommt viel, wer wenig? In den USA oder Großbritannien ist die Einkommenskluft zwischen den unteren und den oberen zehn Prozent gewaltig. Vier Grafiken zeigen, wie es in Deutschland aussieht – und im Rest der Welt.
Die Verteilung des Einkommens zwischen Löhnen und Profiten ist ein gesellschaftlicher Prozess und kennt daher keine natürlichen Regeln. Dass Unternehmen Kostenschocks einfach so weiterreichen können, während Beschäftige diese mit Reallohnverlusten ausbaden, verweist vielmehr auf die Schwäche der Gewerkschaften und die Stärke des Kapitals. Während Mainstream-Ökonomen immer davor warnen, die Höhe von Löhnen oder Sozialleistungen automatisch an die Inflation anzupassen – was ein Großteil der Deutschen unterstützen würde – sind solche Indexierungen für Kapitaleinkommen de facto der Fall: Wenn Firmen Kostensteigerungen eins zu eins weitergeben können, oder sie wie bei den 70 Prozent Indexmieten in Berlin sogar im Vertrag stehen.
Den ganzen Artikel gibt es hier.
Mit dem Lastenrad fahrendes grünes Großstadtmilieu gegen die Auto fahrende konservative Landbevölkerung. Dieser (vermeintliche) Gegensatz ist allgegenwärtig in der Klimadebatte. Doch was ist eigentlich dran an dieser Polarisierungshypothese? Ein neuer Bericht von Jan Eichhorn, Direktor von d|part, zeichnet ein differenzierteres Bild.
In Debatten zu Klimakrise und Energiewende wird oft ein Bild großer Unterschiede der
Einstellungen von in städtischen und ländlichen Regionen lebenden Menschen gezeichnet. Doch trifft das wirklich zu? Basierend auf repräsentativen Umfragedaten analysiert die vorliegende Studie, wie Menschen in verschiedenen Wohnortsumfeldern über klima- und energiepolitische Themen nachdenken. Dabei zeigt sich, dass es zwischen ihnen generell nur nuancierte Unterschiede in Ansichten zur Wichtigkeit der Klimakrise und der Präferenz für bestimmte Maßnahmen gibt. Allerdings unterscheiden sich die Profile der Menschen, die bestimmte Ansichten über Wohnortsumfelder hinweg teilen, teils deutlich. Das gilt insbesondere auch für Anhänger/innen verschiedener Parteien. Die Analyse zeigt deutlich, dass eine zielgruppenorientierte Ansprache zu Klima- und Energiepolitik dann erfolgversprechend ist, wenn persönliche Charakteristika von Menschen und ihr
Wohnortsumfeld gemeinschaftlich betrachtet werden.
Den ganzen Bericht gibt es hier.
Das Ringen um die grüne Notenbank – Artikel
Christian Siedenbiedel, FAZ, 26.07.2023
Die EZB hat im Juli ihre Anleihekäufe nach Klimakriterien praktisch eingestellt. Greenpeace spricht von einem „gebrochenen Versprechen“. Es gibt neue Ideen – doch die haben einen Haken.
Schulden, Wasserstoff, Inflation – der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm haben große Differenzen. Wer hat die besseren Argumente?
Vor den Wahlen in Italien im vergangenen Herbst wurde Giorgia Meloni weithin als Bedrohung dargestellt. In diesem Sommer wurde ihr alles verziehen – ihre jugendliche Bewunderung für Benito Mussolini, die Verbindungen ihrer Partei zu Neofaschisten, ihre oft extreme Rhetorik -. Frau Meloni, die für ihre Sachlichkeit und ihre Unterstützung für die Ukraine gelobt wurde, hat sich als verlässliche Partnerin des Westens etabliert, die bei Treffen der Gruppe der 7 und bei NATO-Gipfeln gleichermaßen im Mittelpunkt steht.
Die Rechte Mitte in Deutschland nähert sich, wie viele ihrer Pendants in anderen europäischen Ländern, den Nationalisten an, weil sie nicht mehr weiß, wofür sie steht.
KI verändert alles – Artikel
Harold James, Project Syndicate, 26.07.2023
Während frühere technologische Entwicklungen das menschliche Verhalten und Erscheinungsbild veränderten, wird der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz die grundlegenden sozialen und politischen Überzeugungen der Menschen umgestalten, auch was das Wesen und die Rolle des Staates betrifft. Der Einsatz von autonomen Waffen im Krieg ist ein Beispiel dafür.
Das Wirtschaftsministerium sucht nach Wegen, Wohlstand jenseits der Wachstumszahlen zu definieren. Bevölkerung, Wissenschaft und Wirtschaft sind zur Teilnahme aufgerufen.
Wer ein Unternehmen erbt und die Erbschaftsteuer nicht zahlen kann, bekommt es steuerfrei übertragen. Im vergangenen Jahr wurden 24 Menschen so 1,4 Milliarden Euro erlassen. Ist das ein Steuertrick?
Wir haben enge, aber erdrückende soziale Netze gegen ein kapitalistisches Sicherheitsnetz eingetauscht, das uns moderne Lebensoptionen bietet. Jetzt haben wir beides nicht mehr.
Die zunehmende Ungleichheit ist eine Herausforderung für das multilaterale System, schreibt Jayati Ghosh, das sie zunächst richtig messen muss.