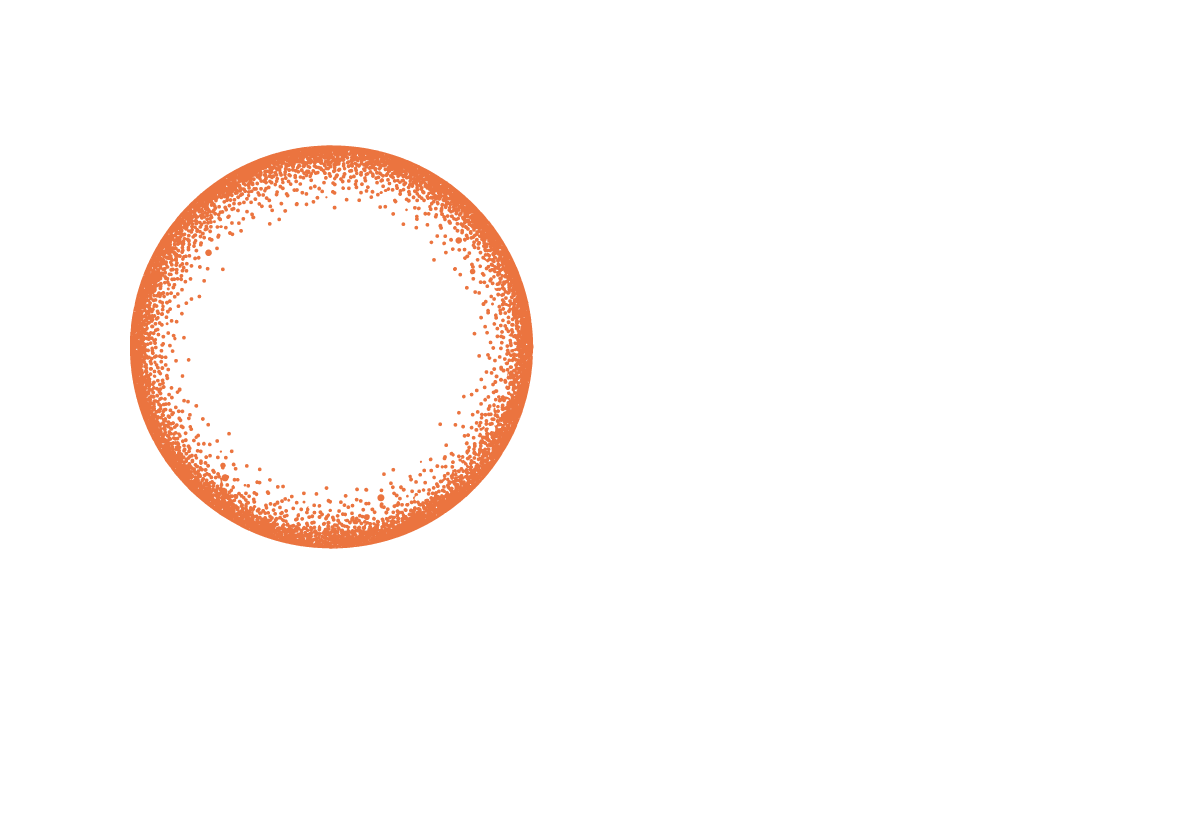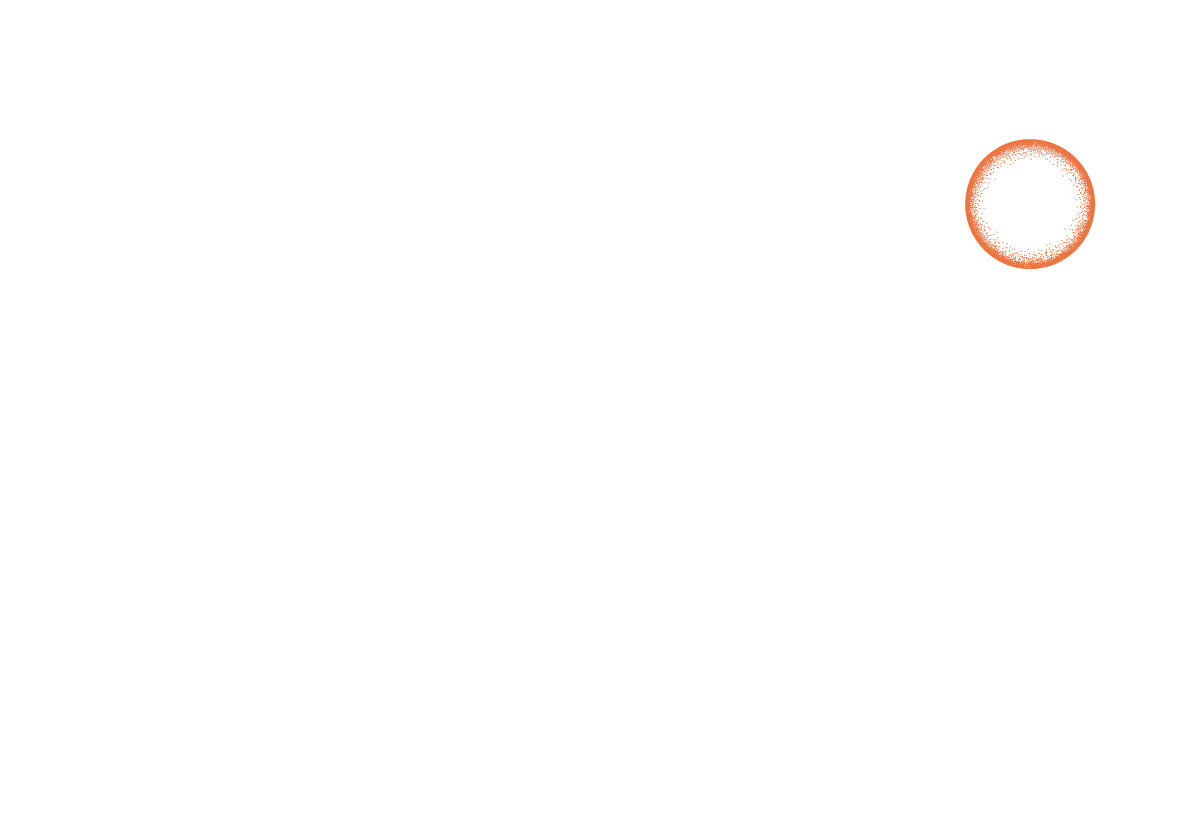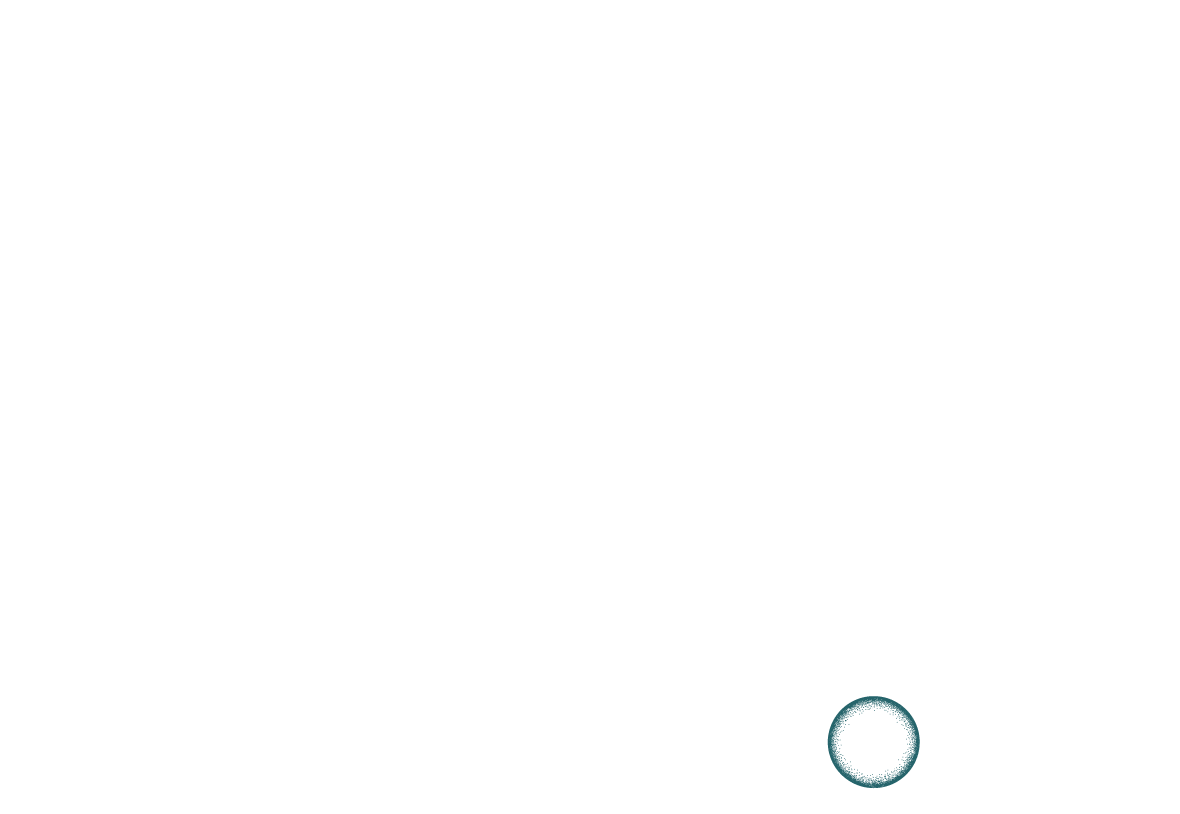Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Europa im Zeitalter der Industriepolitik – Artikel
Michael Spence, Project Syndicate, 26.06.2023
Während China und die USA ihre Größenvorteile nutzen, um umfangreiche Investitionen in kritischen Sektoren zu tätigen, tut sich die EU aufgrund ihrer dezentralisierten Steuerstrukturen und Vorschriften, die staatliche Subventionen für die Industrie begrenzen, schwer, diesem Beispiel zu folgen. Ein neues Investitionsprogramm auf EU-Ebene ist dringend erforderlich.
Was der Markt nicht weiß – Artikel (Paywall)
Lisa Herzog, FAZ, 22.09.2023
Die Marktgläubigkeit stößt an ihre Grenzen, Entscheidungen werden nicht immer ausschließlich rational gefällt. Jetzt ist der vernünftige Bürger gefragt.
Staat ohne Plan – Essay (Paywall)
Georg Diez, die Zeit, 13.09.2023
Nach Jahrzehnten neoliberaler Deregulierung ist der Staat wieder gefragt. Umso mehr bräuchte es hierzulande endlich eine Vision, wie dieser in Zukunft aussehen soll.
Europas Rechtsdrift ist nicht in Stein gemeißelt: Unsere neue Studie sollte der Linken Hoffnung geben – Artikel
Julia Cagé and Thomas Piketty, The Guardian, 26.06.2023
Wir haben die französischen Wahldaten seit der Revolution untersucht – und sie zeigen, dass die Migrationspolitik eine Sackgasse ist.
Deutschland muss jetzt neu durchstarten – Gastbeitrag
Isabella Weber, die Zeit, 08.09.2023
Als Antwort auf die Krise braucht Deutschland jetzt dringend eine umfassende Investitionsagenda. Ein Industriestrompreis ist darin unverzichtbar, aber nur ein Baustein.
Wie Mindestlöhne wirken – Artikel
Bernd Fitzenberger, Mario Bossler, FAZ, 26.09.2023
Hat die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zu einem Rückgang der Beschäftigung in Deutschland geführt?
In ihrem jüngsten Monatsbericht warnt die Deutsche Bundesbank eindringlich vor der wirtschaftlichen Anfälligkeit des Landes aufgrund seiner starken Abhängigkeit vom Handel mit China. Der Bericht nennt mehrere Schlüsselfaktoren, die das deutsche „Geschäftsmodell“ gefährden, darunter die Abhängigkeit von China, hohe Energiepreise und Arbeitskräftemangel. Der Bundesbank zufolge trägt auch die Abkehr vom Handel mit China zur wirtschaftlichen Abschwächung bei, wobei der IWF für 2023 einen Rückgang des Wachstums um 0,3 % erwartet.
Lesen Sie hier den gesamten Bericht, der auch in diesem Artikel der Financial Times behandelt wird.
Thinkin’ Bout a Revolution – Artikel
Branko Milanovic, Makronom, 07.09.2023
Die scheinbar antikapitalistische Revolution von 1968 hat die Welt für den Kapitalismus sicher gemacht – und die Positionen der Rechten verstärkt.
Ungleiches Deutschland: Sozioökonomischer Disparitätenbericht 2023 – Studie
Friedrich-Ebert-Stiftung, September 2023
Ungleichheit zwischen städtischen und ländlichen Regionen sowie Unterschiede zwischen wirtschaftlich dynamischen Regionen und solchen, die vom Strukturwandel betroffen sind – Deutschland ist sozial und räumlich ein ungleiches Land.
Olaf Scholz, das unwahrscheinliche Vorbild – Artikel
Robert Misik, Social Europe, 04.09.2023
Ein Staat, der schützt – und ein Bollwerk für Demokratie und Modernität. Ist dies, fragt Robert Misik, das neue Paradigma der demokratischen Linken?
Die EU steht vor einem großen Sprung in Richtung weiterer Integration – Kolumne
Martin Sandbu, Financial Times, 04.09.2023
In der Union wird zunehmend ernsthaft über weitreichende Reformen aller Art gesprochen.
G20 muss sich auf höhere Steuern für Reiche einigen, sagen Aktivisten – Artikel
The Guardian, Larry Elliott, 05.09.2023
Brief von fast 300 Millionären, Ökonomen und Politikern: Dringender Handlungsbedarf, um extremen Reichtum zu verhindern.
Ungleichheit und Demokratie – Artikel
Joseph Stiglitz, Project Syndicate, 31.08.2023
Mit den richtigen politischen Reformen können Demokratien integrativer werden, mehr auf die Bürger eingehen und weniger auf die Konzerne und reichen Einzelpersonen reagieren, die derzeit die finanziellen Fäden in der Hand halten. Die Rettung der demokratischen Politik erfordert jedoch auch weitreichende Wirtschaftsreformen.
Anlässlich ihres 5. Geburtstags veranstaltet der Verein Finanzwende in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung am 13.09.2023 um 18:00 Uhr eine Paneldiskussion in Berlin.
Vor dem Hintergrund der Klimakrise und der zunehmenden Finanzialisierung von Bereichen wie Gesundheit oder Wohnen werden Fragen laut, welche Rolle der Finanzmarkt bei diesen Entwicklungen spielt. In der Podiumsdiskussion soll es darum gehen, wie für eine soziale und ökologische Transformation der Finanzmarkt gefördert, neu ausgerichtet und zurückgedrängt werden muss. Diskutieren werden: Claudia Kemfert, Gerhard Schick, Jörg Asmussen und Reiner Hoffmann. Verena von Ondarza moderiert.
Hier geht es zur Anmeldung.
Neue EU-Fiskalregeln gefährden notwendige Investitionen zur Bekämpfung der Klimakrise – Studie
Sebastian Mang & Dominick Caddick, New Economics Foundation, 31.08.2023
Eine dringend notwendige Reform der EU-Steuerregeln ist endlich auf den Weg gebracht. Die von der Kommission vorgeschlagenen Regeln sind jedoch unverantwortlich – sie gefährden die öffentlichen Investitionen, die zur Bekämpfung des Klimawandels notwendig sind.
Willkommen zur großen Neunzigershow! – Kolumne
Lenz Jacobsen, die Zeit, 22.08.2023
Kranker Mann Europas, Sozialtourismus, Ruck: Die CDU bringt die Rhetorik der Neunziger zurück. Das sagt möglicherweise mehr über die Partei aus als über die Gegenwart.
»Wir degradieren den Menschen zum Handlanger« – Interview (Paywall)
Interview Benjamin Bidder, der Spiegel, 25.08.2023
Reiche und Mächtige haben zu allen Zeiten Innovationen gekapert, sagt Topökonom Daron Acemoğlu – schon im Mittelalter und nun auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Stürzt das Silicon Valley die Menschheit ins Elend?
Merz fordert Grundsatzdebatte über Leistungsbereitschaft – Artikel
Der Spiegel, 31.08.2023
CDU-Chef Friedrich Merz fürchtet um den Wohlstand in Deutschland. Verantwortlich für die abnehmende Wirtschaftsleistung ist seiner Ansicht nach die Ampelkoalition. Leistung werde von der Regierung bestraft.
Wachstum neu denken und den Unternehmerstaat überdenken – Artikel
Mariana Mazzucato, Project Syndicate, 28.08.2023
Wirtschaftswachstum ist zwar wichtig, aber abstrakt betrachtet kein kohärentes Ziel oder eine Aufgabe, an der Regierungen ihre Politik ausrichten sollten. Die Art von integrativem, nachhaltigem und robustem Wachstum, die sie anstreben, ist letztlich ein Nebenprodukt der Verfolgung anderer gesellschaftlich nützlicher kollektiver Ziele.
Die fünf globalen wirtschaftlichen Umwälzungen, die jetzt stattfinden – Artikel
Chris Giles, Financial Times, 29.08.2023
Da Unsicherheit und Inflation die Zentralbanker und politischen Entscheidungsträger herausfordern, müssen sie sich auch an strukturelle Veränderungen anpassen.
Deutschland unterschätzt das größte Wachstumsrisiko – Kommentar
Julian Olk, Handelsblatt, 28.08.2023
Die Abstiegsrhetorik ist allenfalls in Teilen gerechtfertigt. Das eigentliche Problem: Der politische Druck ist ausgerechnet da gering, wo der Reformbedarf am größten ist.
Finanzielle Sicherheit von Familien entscheidet über Bildungsaufstieg – Artikel
Zeit Online, AFP, 28.08.2023
Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, welche Faktoren den Bildungsweg von Kindern bestimmen. Die größte Hürde sind finanzielle Probleme.