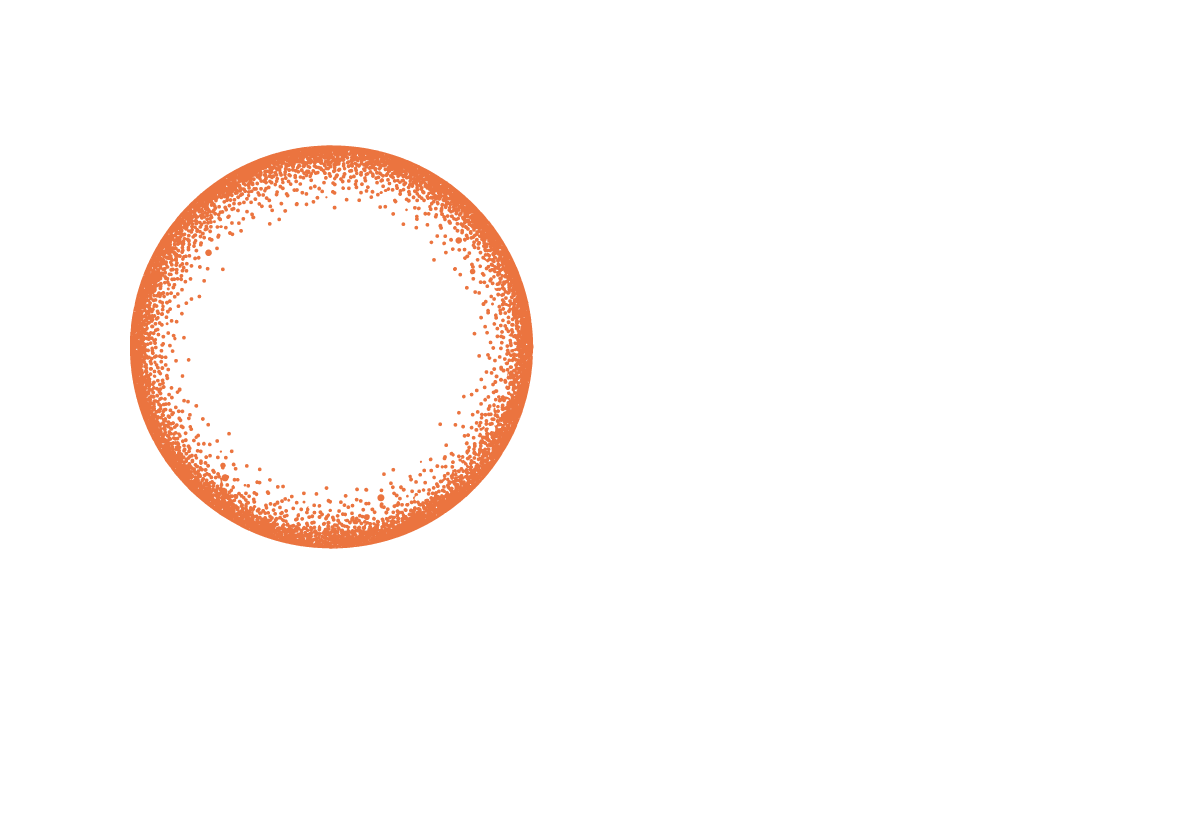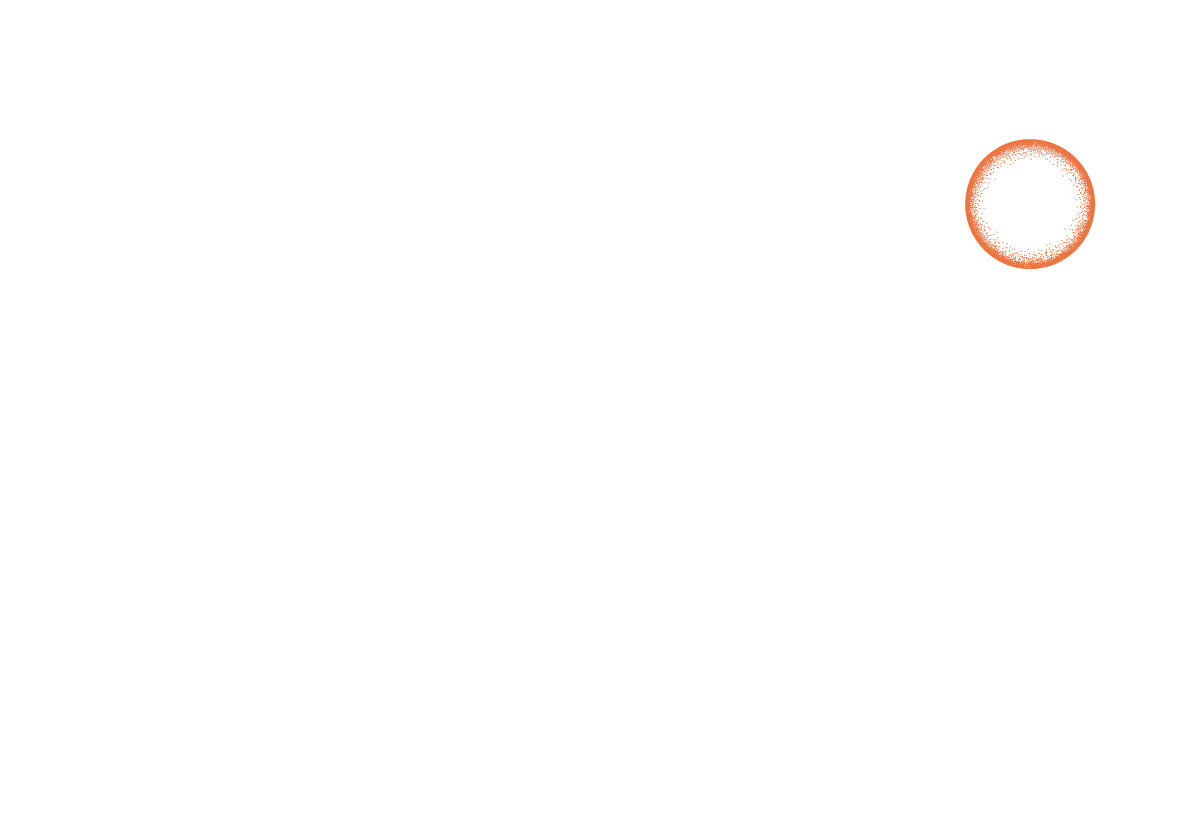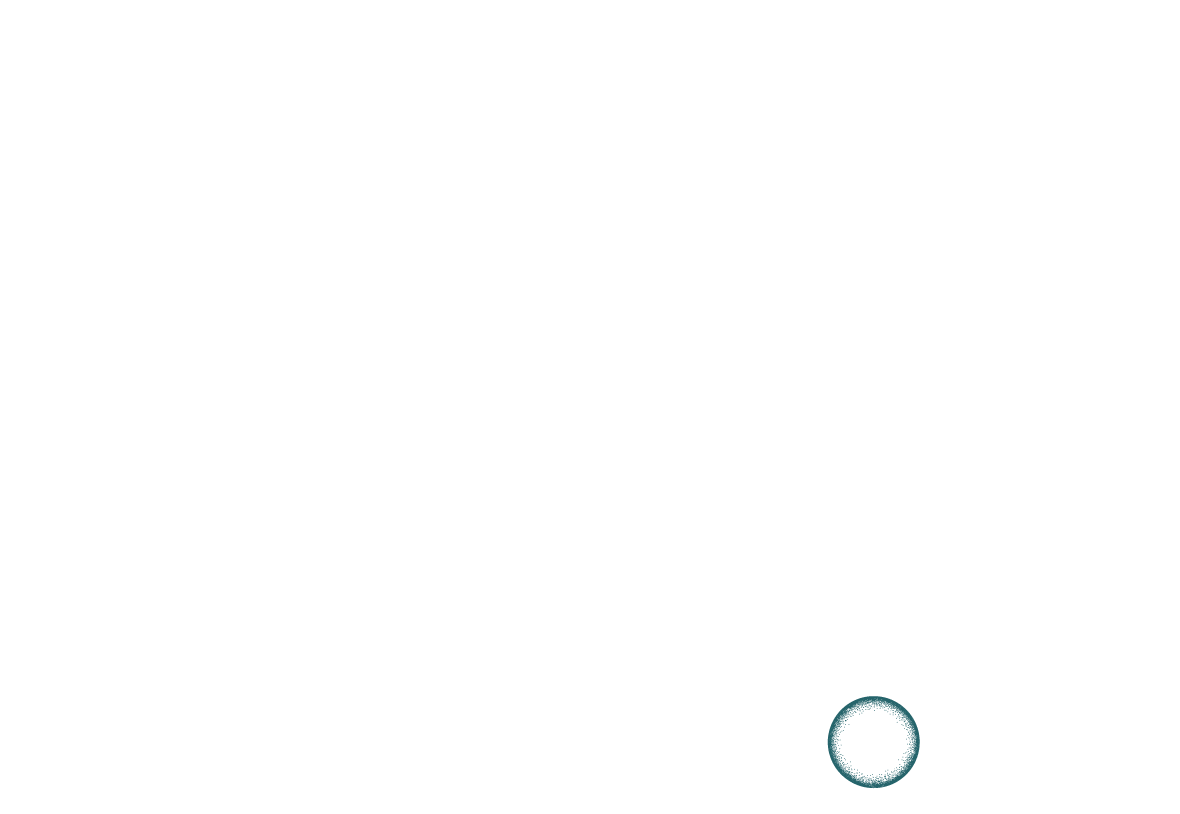Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
Monster des Mainstreams – Artikel
Quinn Slobodian, The New Statesman, 20.11.23
Argentiniens neuer Präsident Javier Milei verkörpert den Zombie-Neoliberalismus der 1990er Jahre.
Warum die Mainstream-Wirtschaft die Inflation falsch einschätzt – Blogpost
James K. Galbraith, 15.11.23
Die Fehldiagnose führender Ökonomen in Bezug auf die Inflation 2021-22 war die jüngste Episode in einer langen Reihe von Fehlern, von der Nichtvorhersage der Finanzkrise 2008 bis zur Befürwortung selbstzerstörerischer Sparmaßnahmen in den 2010er Jahren. Entweder müssen die Mainstream-Ökonomen ihre Grundüberzeugungen überdenken, oder der Berufsstand braucht einen neuen Mainstream.
« Die USA und die EU müssen ein UN-Steuerabkommen unterstützen » – Artikel (Paywall, Französisch)
Collectif, Le Monde, 21.11.23
Vierzehn Wirtschaftswissenschaftler, Juristen und ehemalige Politiker – darunter Jayati Ghosh, Joseph Stiglitz und Thomas Piketty – warnen vor der entscheidenden Abstimmung am Mittwoch, den 22. November, in den Vereinten Nationen über eine Resolution zur internationalen Zusammenarbeit in Steuersachen.
Die besten Bücher des Jahres 2023 – Wirtschaft – Artikel
Martin Wolf, Financial Times, 15.11.23
Martin Wolf wählt seine besten Lektüren für die zweite Hälfte des Jahres 2023 aus.
Dreieinhalb Ideen für eine neue Schuldenbremse – Artikel
Fabian Franke, Die Zeit, 24.11.23
Christian Lindners Lösung für die Haushaltskrise ist kurzfristig, die Forderungen nach einer Reform der Schuldenbremse bleiben bestehen. So könnte sie aussehen.
Das verborgene Wohlstandsgefälle zwischen den Geschlechtern – Artikel
Celine Bessiere & Sibylle Golac
So wichtig die Lohngleichheit und andere Fortschritte auf dem Arbeitsmarkt für Frauen auch waren, die Fortschritte auf dem Weg zur wirtschaftlichen Gleichstellung mit den Männern sind nach wie vor gering und unvollständig. Da es bei der Ungleichheit weniger um Löhne und mehr um Vermögen geht, sehen sich Frauen erneut mit tiefgreifenden strukturellen Nachteilen konfrontiert.
„Die Demokratie hat nicht geliefert, was sie versprochen hat“ – Interview (Paywall)
Markus Zydra, Süddeutsche Zeitung, 21.11.23
Der Ökonom Raghuram Rajan sah die globale Finanzkrise voraus – und erkennt jetzt wieder Bruchstellen im System. Wo die liegen, warum sich gerade so viele Menschen autoritären Regimen zuwenden und was man dagegen tun kann.
Das Dezernat Zukunft hat eine neue Info-Seite rund um die deutsche Schuldenbremse veröffentlicht. Die Website erklärt und visualisiert die Fiskalregel auf drei Ebenen. Erstens, wie sie zustande gekommen ist. Zweitens, wie sie eigentlich funktioniert. Und drittens, wie man sie reformieren könnte.
Die Auswirkungen der Schuldenbremse auf Haushalt, Bildung, Infrastruktur und Gesellschaft sind gewaltig. Trotzdem verstehen sie nur wenige. Und Fachleute zweifeln, ob sie wirklich zukunftsfest ist. Ein Erklärungsversuch inklusive Reformvorschlag.
Hier geht es zur Seite.
In einem kürzlich erschienenen Zeit-Artikel werden die Ergebnisse des neuen Vermögens-Simulators des Forums „ReBalance“ diskutiert, der heute gelauncht wurde. Ein zentrales Ergebnis des Simulators ist, dass sich die Vermögensungleichheit in Deutschland ohne Reformen über die nächsten zehn Jahre erhöhen würde.
Im Kapitalismus bedeutet Kapital Freiheit. Und in Deutschland ist es höchst ungleich verteilt. Das gilt nicht nur für das Erbe, sondern für das Vermögen insgesamt. Nach Berechnungen des Forum New Economy, einem Zusammenschluss von Wirtschaftswissenschaftlern, halten die oberen zehn Prozent der Vermögenden in Deutschland 61 Prozent aller Vermögen, die obere Mittelschicht 38 Prozent. Der ärmeren Hälfte der Bevölkerung gehören insgesamt nur 1,4 Prozent des Vermögens.
Der Artikel legt dabei einen Fokus auf die Effektivität und die Finanzierbarkeit verschiedener Vorschläge eines Grunderbes.
Aber wie viel könnte so ein Grunderbe überhaupt an der ungleichen Verteilung der Vermögen in Deutschland ändern? Dazu veröffentlicht das Forum New Economy am Freitag dieser Woche neue Berechnungen. Die Ergebnisse liegen der ZEIT vorab vor. Sie zeigen: Um eine spürbare Wirkung zu erzeugen, müsste das Grunderbe ziemlich hoch ausfallen – und wäre entsprechend teuer. Erhält jeder Deutsche zur Volljährigkeit 10.000 Euro, würde das gerade einmal reichen, um die heutige Vermögensverteilung zu bewahren, also eine weitere Umverteilung nach oben zu verhindern. Mit 20.000 Euro käme die ärmere Hälfte der Bevölkerung immerhin auf 2,7 Prozent aller Vermögen. Der Staat müsste dafür jedes Jahr 17 Milliarden Euro aufbringen, das ist mehr Geld, als der Bund für Gesundheit ausgibt. Wenn die Regierung zu jedem 18. Geburtstag gar 60.000 Euro überweisen soll, wie es die Jusos fordern, stiege der Vermögensanteil der unteren Hälfte auf immerhin fünf Prozent. Das würde aber auch 65 Milliarden Euro im Jahr kosten, weit mehr als der gesamte Verteidigungshaushalt.
Zum Vermögens-Simulator ReBalance geht es hier.
In einer kürzlich erschienenen Kolumne argumentiert Rana Foroohar, dass die jüngste wirtschaftliche Erholung in den USA die bewusste Entscheidung der Regierung Biden widerspiegelt, der Pandemiebekämpfung und der Beschäftigung den Vorrang vor einem Inflationsanstieg einzuräumen. Vergleicht man den jüngsten Aufschwung mit dem nach der Finanzkrise 2008, so scheint der frühere Konsens, eine höhere Arbeitslosigkeit aufgrund von fiskalisch bedingten Inflationsrisiken zu akzeptieren, gebrochen zu sein.
Ich denke jedoch, dass die derzeitige Wirtschaftslage in den USA etwas Wichtiges widerspiegelt: Die Art des Aufschwungs, die wir haben, ist eine Entscheidung. In der Vergangenheit haben wir uns hauptsächlich für eine hohe Arbeitslosigkeit anstelle von mehr Fiskalpolitik entschieden, von denen viele Ökonomen befürchteten, dass sie die Inflation zu schnell ansteigen lassen würden (man denke nur an Larry Summers und Jason Furman und die ganze Idee, dass Fiskalpolitik „schnell, vorübergehend und gezielt“ sein müsse).
Foroohar zufolge führte diese Entscheidung zu einer überschaubaren Inflation, stabiler Beschäftigung und einem verbesserten finanziellen Wohlergehen des Durchschnittsamerikaners und einer Abkehr von der Idee eines Zielkonflikts zwischen Main Street und Wall Street. Der richtungsweisende Ansatz der Biden-Regierung könnte als vielversprechendes Beispiel dafür dienen, wie die richtigen Politikentscheidungen zu einer gerechteren und wohlhabenderen Zukunft führen können.
Lesen Sie den ganzen Artikel hier (Paywall).
„Die Frage ist, ab welchem Punkt sich Ungleichheit nachteilig auswirkt“ – Interview (Paywall)
Interview: Dieter Schnaas, Wirtschaftswoche, 30.10.2023
Gerechtigkeitsforscher Branko Milanović spricht über Unwuchten der Einkommensverteilung, Lehren aus der Wirtschaftsgeschichte – und das vorläufige Ende seiner Elefantenkurve.
Diese Grundlagen wünschen sich die Deutschen für die Wirtschaft – Artikel
Julian Olk, Handelsblatt, 24.10.2023
Wärmepumpe und Mietpreise haben in der Politik große Debatten über die Rolle des Staates ausgelöst. Aber wo steht die Bevölkerung? Eine Umfrage zeigt: Oft soll es der Staat richten.
„Das Bild vom kranken Mann halte ich für völlig übertrieben“ – Interview (Paywall)
Interview: Thomas Fromm & Maike Schreiber, Süddeutsche Zeitung, 31.10.2023
Der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze glaubt nicht, dass der Standort Deutschland abgemeldet ist. Allerdings gäbe es für die Regierung einige sehr wichtige Dinge zu tun.
Soziologen über gesellschaftliche Triggerthemen: „Viele Menschen sind veränderungserschöpft“ – Artikel (Paywall)
Hans Monath, Tagesspiegel, 26.10.2023
Wann empfinden wir Politik als konstruktiv? Und wann emotionalisiert sie uns? Thomas Lux und Steffen Mau erforschen und deuten das gefährliche Reizpotenzial etwa von Gendersternchen und Heizungsgesetz.
Biden öffnet sich für KI-Regulierung – Artikel
Rana Foroohar, Financial Times, 30.10.2023
Die USA sind der größte Innovator im Bereich der KI, aber haben sie nur langsam reguliert.
Narzissmus der kleinen Unterschiede verzögert Einigung über EU-Steuerregeln – Kolumne
Martin Sandbu, Financial Times, 22.10.2023
Der Block der 27 Länder muss sich bald einigen, um sich auf weitaus größere wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen vorzubereiten.