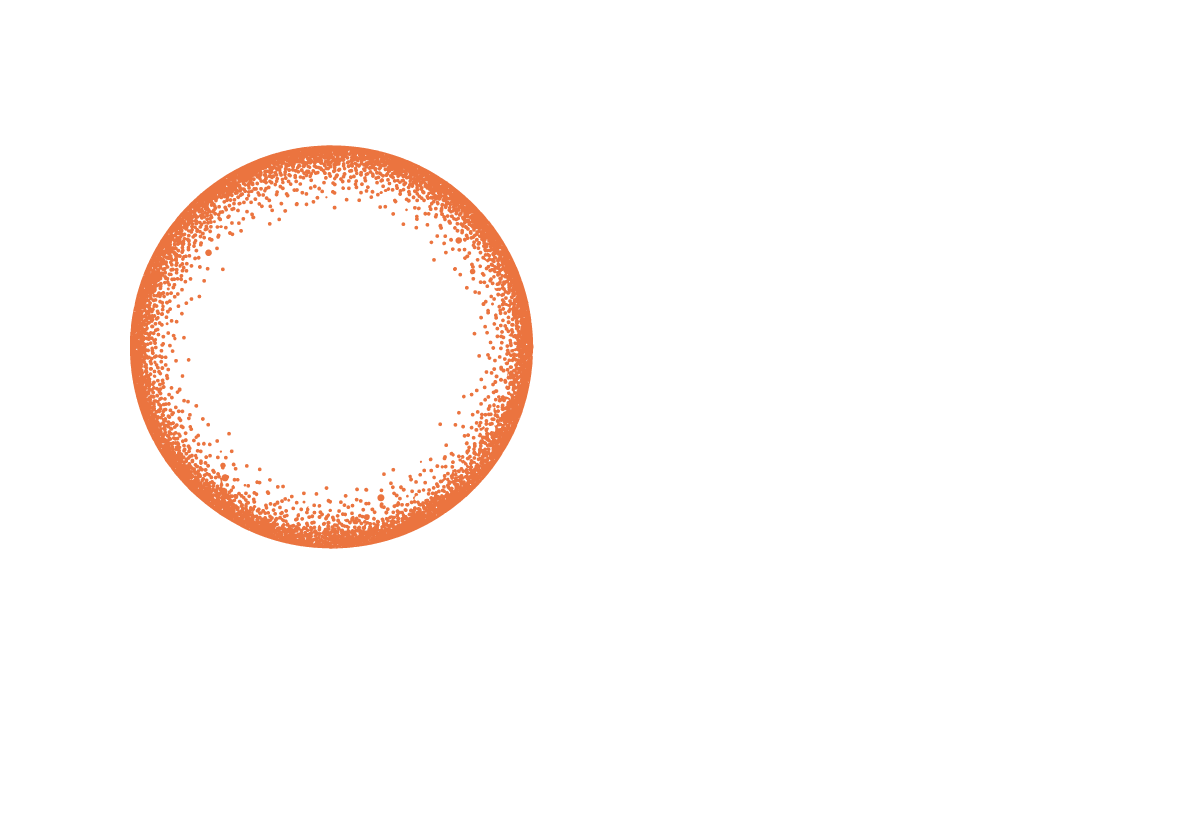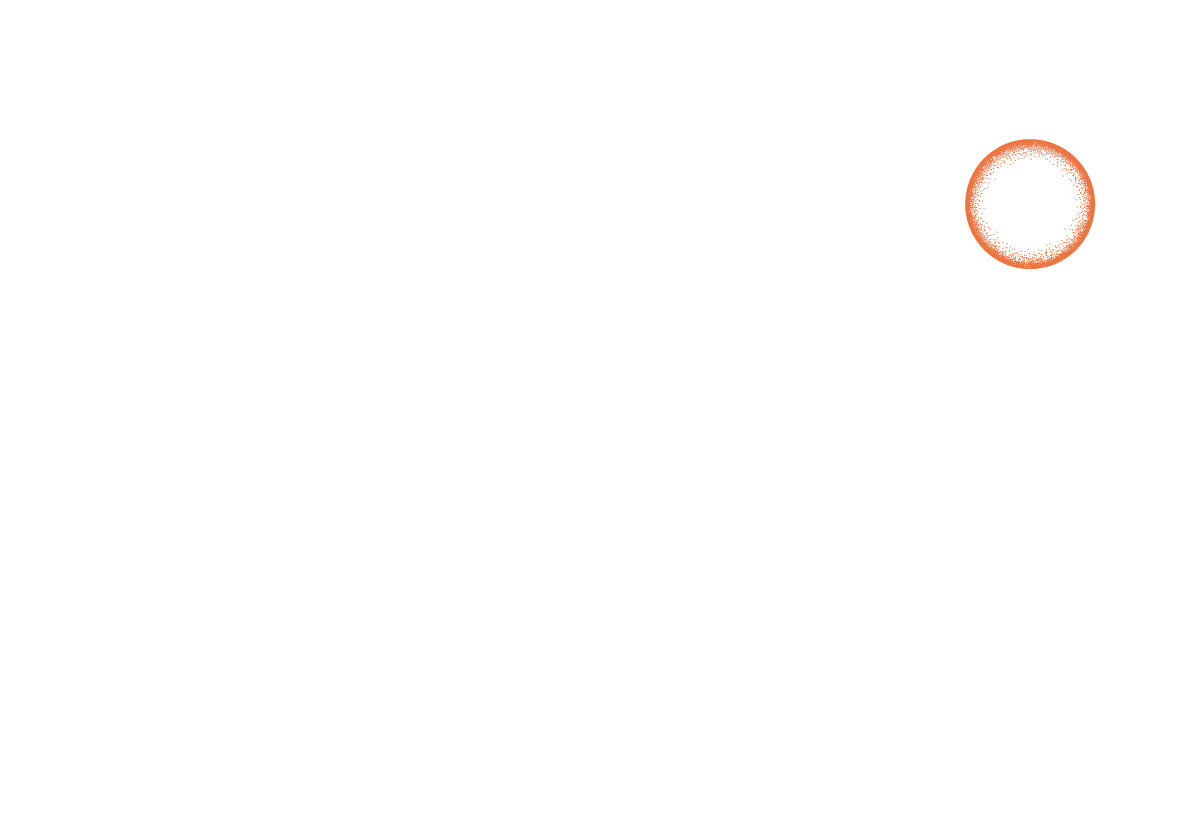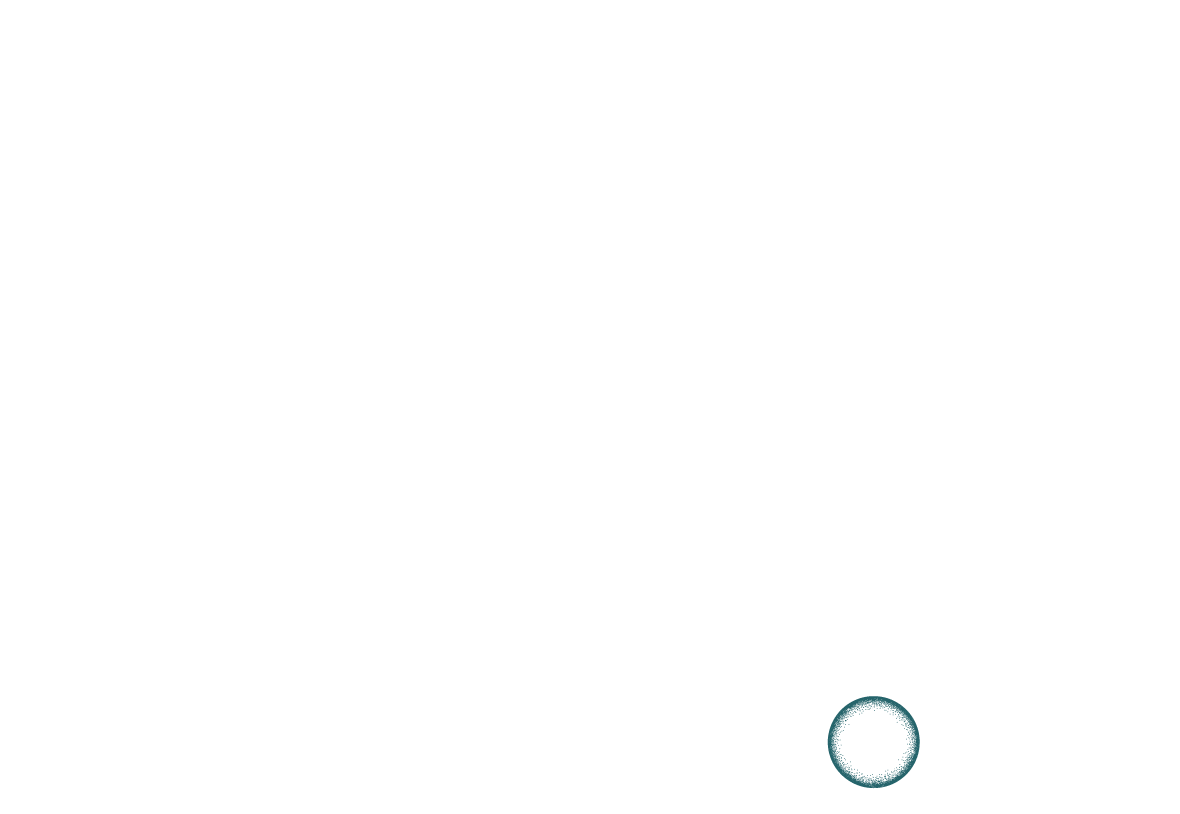Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
IWF: Deutschland soll investieren – Artikel
Winand von Petersdorff-Campen (Washington), FAZ, 25.10.2024
Auf der Jahrestagung des IWF und der Weltbank verstummt die Kritik an der deutschen Schuldenbremse nicht. Finanzminister Christian Lindner will nicht länger über den Sparkurs philosophieren.
Ökonom beziffert Sondervermögen für Investitionen auf eine halbe Billion Euro – Artikel
Jens Südekum, Welt, 28.10.2024
Die Investitionspläne von SPD und Grünen dürften nach Schätzung des Ökonomen Jens Südekum eine halbe Billion Euro bis 2030 kosten – und sie sorgen für Streit. Der Wirtschaftsberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt vor einem „konjunkturellen Strohfeuer“.
„Das Leseverständnis von Ökonomen ist sehr begrenzt“ – sagt ein Ökonom – Artikel
Jannik Tillar im Interview mit Tom Krebs, Capital, 22.10.2024
Das, was Ökonomen der Politik empfehlen, sei unterkomplex – meint Ökonom Tom Krebs. Ein Teil der aktuellen Probleme beruhe auf naiven Vorstellungen, wie die Wirtschaft funktioniert.
Das Problem mit den Boomer-Ökonomen – Artikel
Maurice Höfgen, taz-Kolumne ‘Was kostet die Welt?’, 27.10.2024
Boomer erklären uns die Wirtschaft mit den immer gleichen Gedanken und schlimmen Worthülsen. Unser neuer Kolumnist macht damit Schluss.
US-Wahl: Wie können sich Deutschland und die EU wappnen? –Artikel (Paywall)
FAZ Gastbeitrag von Lisandra Flach, Clemens Fuest, 28.10.2024
Die Handelsbeziehungen mit den USA bleiben unabhängig vom Wahlausgang herausfordernd. Doch es gibt einige Rezepte für die EU-Wirtschaftspolitik.
Was ist Kamalanomics? Mit James Politi – Podcast
FT Podcast The Economics Show with Soumaya Keynes, 21.10.2024
Das Wirtschaftsprogramm der Kandidatin im Überblick.
Frauen werden über Amerikas Zukunft entscheiden – Artikel (Paywall)
Rana Foroohar, Financial Times, 28.10.2024
Das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen wird maßgeblich vom Votum der Wählerinnen abhängen.
“Great Power Politics” – Artikel
London Review of Books Vol. 46 No. 21, 7 November 2024
Adam Tooze über Bidenomics.
Klimawandel und makroökonomische Modelle: Warum allgemeine Gleichgewichtsmodelle nicht funktionieren – Artikel
Yannis Dafermos, Andrew McConnell, Maria Nikolaidi, Servaas Storm, Boyan Yanovski, INET, 28.10.2024
Die Grenzen des E-DSGE-Referenzrahmens und wie diese Grenzen die Fähigkeit dieses Rahmens einschränken, die makroökonomischen Auswirkungen der Klimakrise sinnvoll zu erfassen.
Der falsche Paradigmenwechsel – Artikel
Samuel Decker, Makronom, 17.10.2024
Der Staat interveniert immer stärker in die Wirtschaft. Doch Freude über einen ökonomischen Paradigmenwechsel wäre verfrüht.
In einer gut laufenden Wirtschaft zählt nicht nur der Preis, sondern auch die Macht – Artikel (Paywall)
Rana Foroohar, Financial Times, 21.10.2024
Das ist die Lehre, die man sowohl aus der Gründung des Bretton-Woods-Systems vor 80 Jahren als auch aus der heutigen Regierung Biden ziehen kann.
Vier ökonomische Wahrheiten, die den bizarren US-Wahlkampf erklären – Artikel (Paywall)
Robert Armstrong, Financial Times, 17.10.2024
Ein Besuch in Amerikas drittgrößtem Einkaufszentrum bietet Antworten auf die Frage, was wirklich vor sich geht.
Wirtschaftsnobelpreis: Demokratie ist gut fürs Wachstum – Artikel (Paywall)
Alexander Hagelüken, Süddeutsche Zeitung, 15.10.20224
Der Ökonom Daron Acemoğlu erklärt, warum Länder reich werden oder arm bleiben. Der Wirtschaftsnobelpreis an ihn und zwei Kollegen wirkt wie ein politisches Signal – an Europa und die USA, wo Rechtspopulisten wie Trump die Demokratie aushöhlen wollen.
Der Nobelpreis für ‘Econsplaining’ – Artikel (Paywall)
Brendan Greeley, Financial Times, 21.10.2024
Acemoglu, Johnson und Robinson erhielten einen Preis dafür, dass sie die Wirtschaftswissenschaften auf genau die Dinge angewendet haben, die die Wirtschaftswissenschaften von Natur aus schlecht erklären können.
Die kolonialen Ursprünge der Ökonomie – Kommentar
Ingrid Harvold Kvangraven, Surbhi Kesar, Devika Dutt, Economic & Political Weekly, 19.10.2024
Indem Daron Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson eine einfache und elegante – wenn auch falsche – „Antwort“ auf den komplexen Entwicklungsprozess lieferten, hat ihr Aufstieg zur Prominenz einem ganz bestimmten Verständnis von Entwicklung Vorschub geleistet, das heute in der Disziplin vorherrscht.
So erbt Deutschland – Artikel
Nathanael Häfner, ZEIT ONLINE, 20.10.20224
Die Deutschen vermachen ihren Nachkommen vor allem Bargeld, zeigt eine Studie. Sie macht außerdem deutlich: Wohlstand häuft sich über Generationen an.
Vier-Tage-Woche ohne Gehaltseinbußen bringt vor allem Vorteile – Artikel
Handelsblatt, 18.10.2024
Freitags immer frei und trotzdem wie in einem Vollzeit-Job bezahlt werden: Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Verfechter der Vier-Tage-Woche halten das aber für praxistauglich.
Was kostet mich die SPD? – Artikel (Paywall)
Mark Schieritz, ZEIT ONLINE, 15.10.20224
Die Sozialdemokraten wollen mit einer Steuerreform die Reichen belasten und die Armen entlasten. Aber wer würde wirklich davon profitieren? ZEIT ONLINE hat nachgerechnet.
Wer braucht ein neues Wirtschaftsparadigma? – Artikel (Paywall)
Andrés Velasco, Project Syndicate, 10.10.2024
Die meisten Wirtschaftswissenschaftler reagieren allergisch auf großspurige Forderungen nach neuen Agenden und Paradigmen. Aber bei nützlichen Paradigmen geht es um Prinzipien, und eine Reihe von Prinzipien, die um ein Paradigma herum organisiert sind, hilft politischen Entscheidungsträgern bei der Suche nach Antworten, die für ihre Länder angesichts ihrer einzigartigen Geschichte am besten sind.
Kann Europa eine innovative Wirtschaft schaffen? – Artikel (Paywall)
Philippe Aghion, Mathias Dewatripont, Jean Tirole, Project Syndicate, 07.10.2024
Nach den 30 „glorreichen“ Jahren des Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg haben es die europäischen Politiker versäumt, die Institutionen und Maßnahmen zur Förderung disruptiver Innovationen zu verabschieden. Jetzt muss Europa dringend eine neue Wirtschaftsdoktrin und eine Reformagenda verabschieden, sonst wird es weiterhin hinter den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zurückfallen.
Wie „Überreichtum“ begrenzt werden könnte – Artikel (Paywall)
Lisa Nguyen, Süddeutsche Zeitung, 13.10.2024
In München diskutieren führende Wissenschaftler wie Thomas Piketty, wie sich die Schere zwischen Arm und Reich schließen ließe. Das Vorbild: Eine radikale Maßnahme der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die unangenehme fiskalische Arithmetik, die das britische Wachstum bremst – Artikel (Paywall)
Andy Haldane, Financial Times, 11.10.2024
Der Umfang der erforderlichen öffentlichen Investitionen passt nicht zu den derzeitigen Haushaltsregeln, aber es gibt einen Ausweg.
So hat uns eine Fehldiagnose in die Dauerkrise gebracht – Artikel (Paywall)
Tom Krebs, Handelsblatt, 10.10.2024
Ökonomen machen Alterung, Bürokratie und fehlenden Leistungswillen für die Wachstumsschwäche verantwortlich und lenken damit von den wahren Problemen ab, diagnostiziert Gastautor Tom Krebs.
„Es herrscht Einigkeit und trotzdem geht nichts voran“ – Interview (Paywall)
Christian Rickens, Handelsblatt, 10.10.2024
In den deutschen Debatten scheinen die Extreme zu dominieren. Dabei sei der Konsens in Deutschland breiter denn je, sagt der Soziologe Steffen Mau im Interview. Der Staat wisse es nur nicht zu nutzen.
Der Krach der „Wirtschaftsweisen“ eskaliert – Artikel (Paywall)
Patrick Welter, FAZ, 08.10.2024
Der seit Monaten schwelende Streit im Sachverständigenrat Wirtschaft landet vor Gericht. Veronika Grimm verklagt das Gremium. Es geht um einen Verhaltenskodex.
Wer wird US-Präsident, Allan Lichtman? – Interview
Interview von Rieke Havertz, Zeit Online, 08.10.2024
Der Historiker sagt verlässlich voraus, wer US-Wahlen gewinnt. Er analysiert Kandidaten wie Erdbeben. Klingt irre, aber funktioniert. Diese Wahl? Sei schon entschieden.
SPD-Generalsekretär stellt Merz’ Gesellschaftsbild infrage – Artikel
Marc Röhlig, Der Spiegel, 14.10.2024
Die SPD will Reiche stärker besteuern, CDU-Chef Merz fürchtet um die »Leistungsträger« im Land. Das Zitat nutzt der neue SPD-Generalsekretär Miersch nun für einen entschiedenen Konter.
Progressive Ökonomen nehmen Stellung zu Kamala Harris‘ Wirtschaftsprogramm – und teilen einige ihrer eigenen Vorschläge – Artikel
Nick Romeo, Capital & Main, 02.10.2024
Experten sagen, dass Maßnahmen wie höhere Steuern für Wohlhabende und eine erweiterte Kinderbetreuung sowohl effektiv als auch populär sind.
Wie die USA das Rennen um die Solarenergie gegen China verloren haben – Artikel
David Fickling, Bloomberg Opinion, 30.09.2024
Der Klimakolumnist von Bloomberg Opinion besuchte Michigan, das ehemalige Herz der Solarindustrie, und China, um zu erfahren, wie der gute, altmodische Kapitalismus gewonnen hat.
Die alte US-Wirtschaftspolitik liegt im Sterben und die neue kann nicht geboren werden – Artikel (Paywall)
Adam Tooze, Financial Times, 07.10.2024
Industrielle Rivalität und Spannungen mit China bilden den Rahmen für eine verwirrende Debatte über den Druck der Globalisierung.
Wie Ökonomen unsere Wirtschaft ruinieren und die Gesellschaft spalten – Artikel
Tom Krebs, Makronom, 07.10.2024
Deutschland steckt in einer Dauerkrise. Dafür verantwortlich sind die Fehldiagnosen marktliberaler Ökonomen, die in der Politik zu viel Gehör fanden. Ein Beitrag von Tom Krebs.
Die Gefahren von Amerikas Chip-Strategie – Artikel (Paywall)
Rana Foroohar, Financial Times, 07.10.2024
Im Inland wurden Fortschritte erzielt, aber die nächsten Schritte im Ausland werden einen großen Unterschied ausmachen.
Mit Harris‘ „Opportunity Economy“ schließt sie in den Umfragen zu Trump auf – Artikel
Richard McGahey, Forbes, 30.09.24
Etwas mehr als 30 Tage vor den Präsidentschaftswahlen stellt Kamala Harris die „Opportunity Economy“ in den Mittelpunkt ihrer Kampagne. Obwohl Donald Trump in den Umfragen einen beträchtlichen Vorsprung vor Joe Biden in Wirtschaftsfragen hatte, ist Harris jetzt in Sachen Wirtschaft praktisch gleichauf mit Trump. Wie schließt ihr Programm die Lücke?
Topökonom verteidigt 1.000-Euro-Prämie – Artikel
Mark Schieritz, Zeit Online, 07.10.2024
Die Anschubfinanzierung für Bürgergeldempfänger wird scharf kritisiert. Jetzt unterstützt Simon Jäger, einer der weltweit führenden Arbeitsmarktexperten, die Idee.
Auto-Krise ist „Quittung für zehn bis 15 Jahre Managementfehler“ – Artikel (Paywall)
Jan Lutz, Clara Thier, Lina Knees und Martin Müller, Handelsblatt, 03.10.2024
Jens Südekum hält die Misere der deutschen Autobauer für selbstverschuldet. Der Politik gibt er eine Mitschuld. Im Interview schlägt er eine neue Prämie vor – aber nicht fürs Abwracken.
EU plant radikalen Umbau des Haushalts – Artikel
Hendrik Kafsack, FAZ, 06.10.2024
Hilfen für Flüchtlinge, sozialer Wohnungsbau oder Biolandwirtschaft: Die EU möchte unter anderem finanzielle Unterstützung an Reformen und Ziele knüpfen. Davon sind aber längst nicht alle begeistert.
„Wir sind an einem kritischen Punkt“ – Artikel (Paywall)
Interview von Bernd Kramer, 24.09.2024
Der amerikanisch-serbische Ökonom Branko Milanović über die wachsende Ungleichheit, unsere fatale Illusion, in einer klassenlosen Gesellschaft zu leben – und das wahre Problem der ständigen technischen Revolution.
Die Schuldenbremse ist weltweit einzigartig – und einzigartig gefährlich – Artikel (Paywall)
Philippa Sigl-Glöckner, Wirtschaftswoche, 30.09.2024
Die Schuldenbremse ist ökonomisch schlecht fundiert und sorgt für unerwünschte Effekte. Warum halten wir an ihr fest? Ein Gastbeitrag.
Kamala Harris‘ Wahlkampfteam glaubt, dass sie mit dem Thema Wirtschaft gewinnen kann. Und zwar so. – Artikel (Paywall)
Shane Goldmacher, New York Times, 26.09.2024
Die Berater von Harris verweisen auf eine Reihe von Umfragen, die zeigen, dass der Vorsprung von Donald Trump bei der entscheidenden Frage, wem die Wähler in Sachen Wirtschaft am meisten vertrauen, immer kleiner wird.
Trumponomics: der radikale Plan, der Amerikas Wirtschaft umgestalten würde – Artikel (Paywall)
Colby Smith, Claire Jones and James Politi, Financial Times, 23.09.2024
Um die Produktion anzukurbeln, verspricht der republikanische Kandidat weitreichende Zölle. Kritiker warnen, dass diese enormen Schaden anrichten und die globalen Spannungen verschärfen würden.
Der Vordenker des neuen Rechtspopulismus – Artikel (Paywall)
Ein Essay von David Bebnowski und Quinn Slobodian, Zeit Online, 28.09.2024
Hierzulande kennt kaum jemand Murray Rothbard. Dabei hat dessen Idee einer „Paläo-Koalition“ nicht nur Javier Milei und Donald Trump geprägt, sondern auch die AfD.
Führende Ökonomen fordern von der EU mehr Tariftreue – Artikel
Tina Groll, Zeit Online, 30.09.2024
Über hundert Wirtschaftswissenschaftler um Thomas Piketty fordern von der EU gerechtere Löhne. Bei Aufträgen dürfe nicht nur der niedrigste Preis entscheiden.
Deutsche Wirtschaft: „Diese Krise kann man nicht mit kaputten Straßen erklären“ – Artikel (Paywall)
Interview: Marcus Gatzke und Marlies Uken, Zeit Online, 26.09.2024
Die Wirtschaft kommt einfach nicht in Fahrt. Warum? Der Ökonom Tom Krebs über falsche Marktgläubigkeit, den AfD-Aufstieg und die unterschätzten Folgen der Energiekrise.
Neue EU-Fiskalregel unterschätzt Bremseffekt des Sparens – Artikel (Paywall)
Philipp Heimberger, Handelsblatt, 30.09.2024
Die EU-Kommission blendet aus, wie sehr ihre Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung das Wirtschaftswachstum etwa in Italien dämpfen. Das schadet auch Deutschland, warnt Gastautor Philipp Heimberger.
Der reformierte Stabilitäts- und Wachstumspakt gefährdet Europa – Artikel
Jan Ovelgönne und Achim Truger, Focus Online, 22.09.2024
Die jüngste Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) sollte eigentlich die Finanzstabilität in der EU gewährleisten und Wachstum fördern. Allerdings droht sie nun das Gegenteil zu bewirken.
Grüne Finanzpolitiker wollen Steuerprivilegien für Reiche abschaffen – Artikel
Christoph Schult, Spiegel, 27.09.2024
Ein Grünen-Papier fordert ein Ende der Steuerfreiheit von Gewinnen aus Immobilienverkäufen und eine »Milliardärsteuer«. Einer der Autoren ist Andreas Audretsch, der designierte künftige Wahlkampfleiter der Partei.
Industriepolitik als demokratische Praxis – Artikel
Amy Kapczynski, Democracy: A Journal of Ideas, 25.09.2024
Industriepolitik kann sowohl unsere Wirtschaft als auch unsere Demokratie stärken – aber wir müssen es richtig angehen.