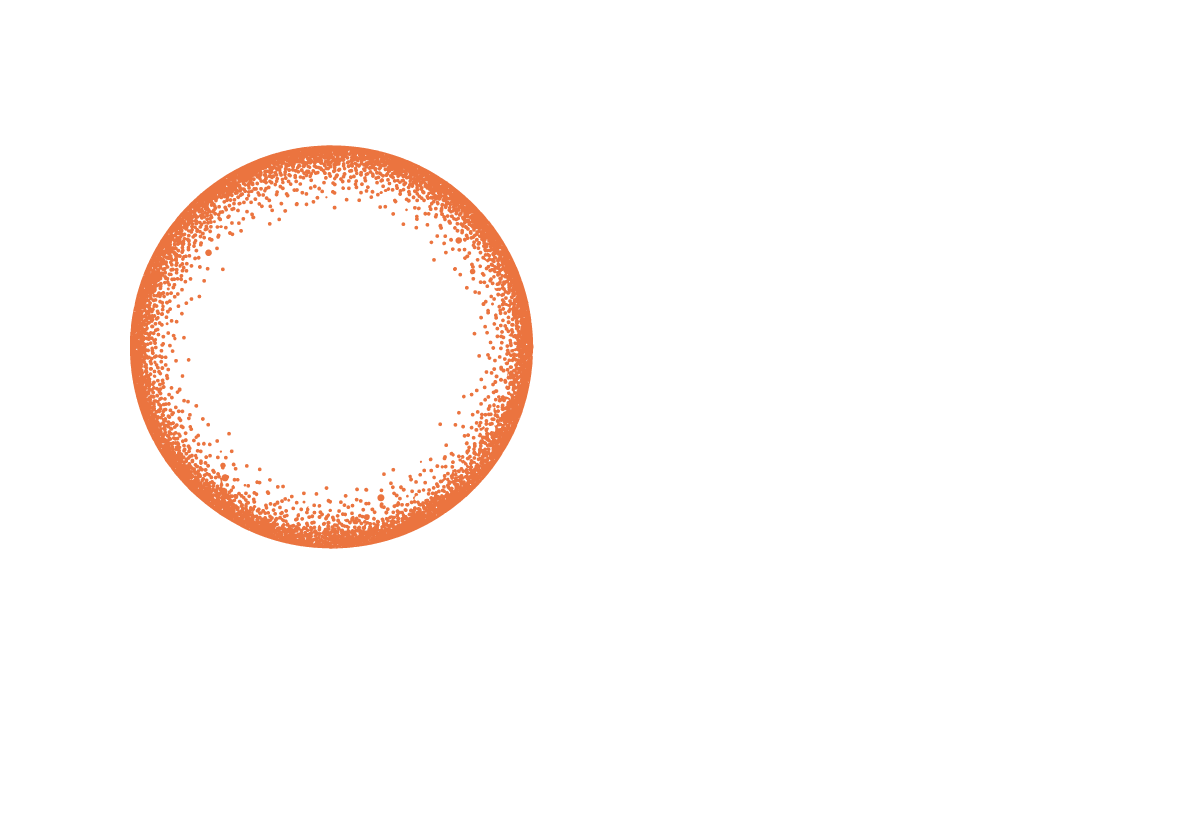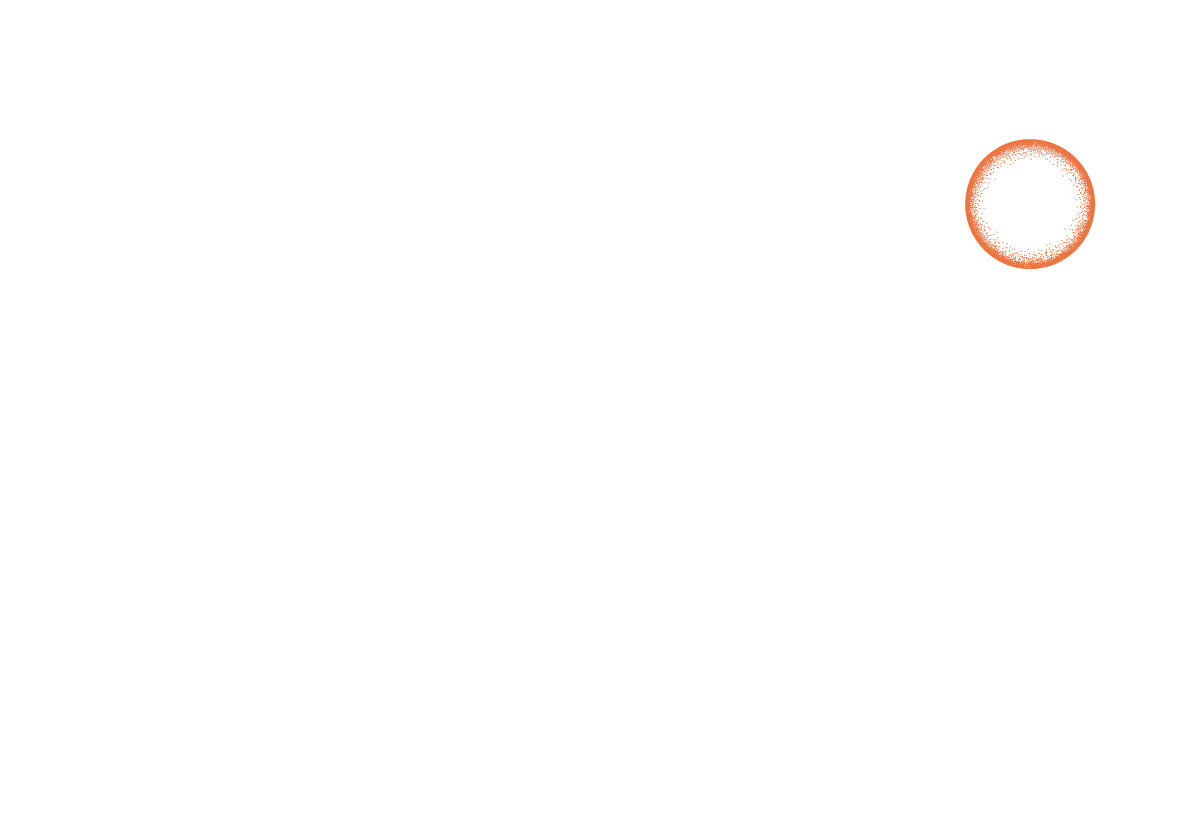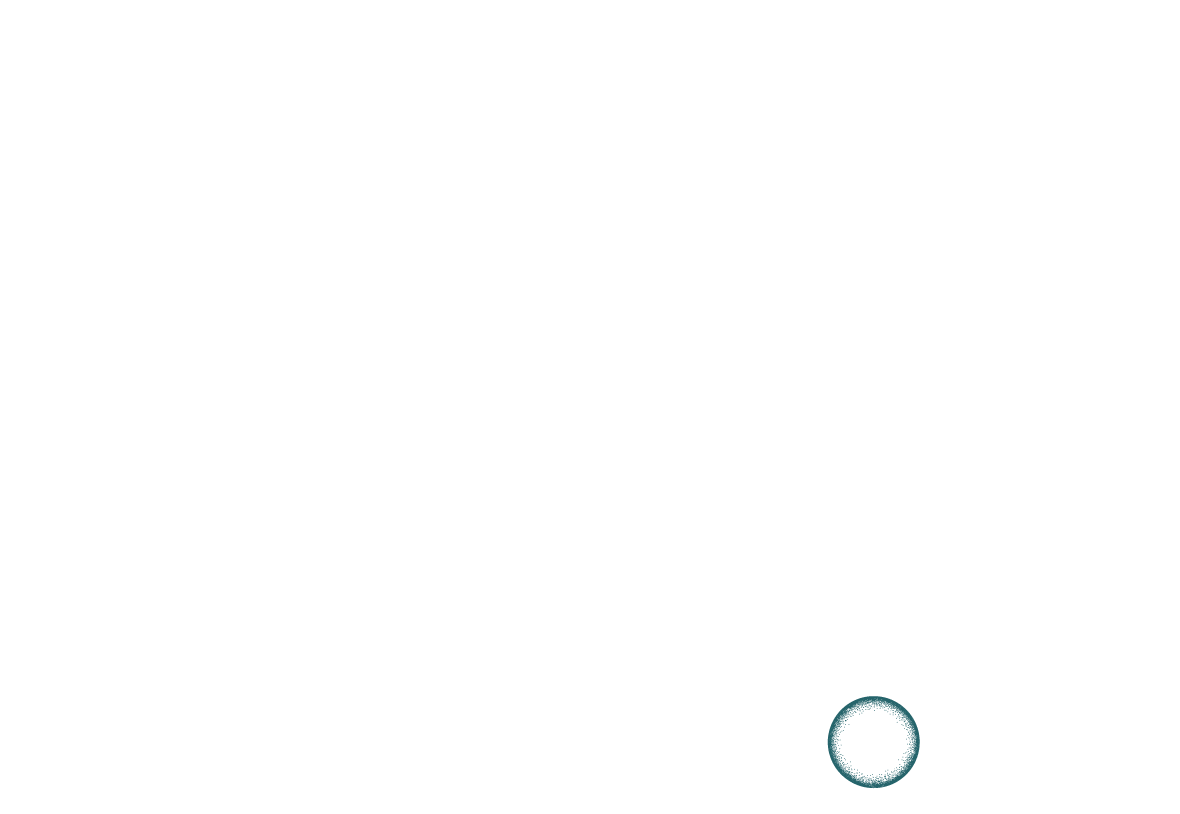Quick & New –
der New-Economy-Ticker
Aktuelle Nachrichten, Debatten, Vorschläge und Entwicklungen zum neuen ökonomischen Denken auf einen Blick.
„Die Schuldenbremse sollte jetzt noch reformiert werden“ – Artikel
Interview: Marlies Uken und Zacharias Zacharakis, Die ZEIT, 26.02.2025
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer plädiert dafür, die Schuldenregelung mit dem alten Bundestag zu ändern. Es gebe eine hohe Dringlichkeit wegen Donald Trumps Politik.
Deutschlands Wahlsieger muss seine Schuldenregeln über Bord werfen – sofort – Artikel (Paywall)
The Economist, 24.02.2025
Friedrich Merz hat Wochen Zeit, um die Abwehrkräfte seines Landes zu stärken.
Von der Leyen plant EU-Sondervermögen für Verteidigung – Artikel (Paywall)
Jakob Hanke Vela, Handelsblatt, 26.02.2025
Die EU-Kommissionspräsidentin warnt vor einem „revanchistischen Russland“ und will Europa per Sofortprogramm aufrüsten – mit integrierter EU-Luftverteidigung, Drohnen und militärischer KI.
„Ein Sondervermögen Verteidigung löst das Problem nicht“ – Artikel (Paywall)
Philippa Sigl-Glöckner im Interview mit Benjamin Ansari, Handelsblatt, 28.02.2025
Die Schuldenbremse bleibt eine der Streitfragen auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung. Die SPD-nahe Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner erklärt, wie eine Reform aussehen könnte.
Europa kann aufrüsten, auch ohne anderswo zu sparen – Artikel
André Kühnlenz, Finanz und Wirtschaft (FuW), 25.02.2025
Europas Zinsen enteilen denen der USA, Anleger stellen sich auf höhere Schulden für die Aufrüstung des Kontinents ein. Auch die Schweiz und Grossbritannien könnten mit der EU kooperieren.
Was europäische Sicherheit benötigt – Artikel (Paywall)
Laurence Tubiana, Project Syndicate, 26.02.2025
In europäischen Politikerkreisen wird heute davon gesprochen, dass Wettbewerbsfähigkeit, Verteidigung und Stabilität Vorrang vor ehrgeizigen Klimazielen haben. Es wäre jedoch ein schwerer wirtschaftlicher Fehler, die Strategie der Europäischen Union für einen grünen Übergang aufzugeben.
Fünf Schlussfolgerungen aus der historischen Wahl in Deutschland – in Charts – Artikel (Paywall)
Anne-Sylvaine Chassany, Martin Stabe und Jonathan Vincent, Financial Times, 24.02.2025
Nichtwähler und junge Menschen wählten die AfD und die extreme Linke und entzogen der CDU ein begeistertes Mandat.
Die Austerität ist zurück – und gefährlicher denn je – Artikel (Paywall)
Mark Blyth, Project Syndicate, 25.02.2025
Eineinhalb Jahrzehnte nach der globalen Finanzkrise ist die Austerität zurückgekehrt. Doch diesmal ist sie nicht nur eine wirtschaftlich gefährliche Idee, die verspricht, eine schlechte Situation noch zu verschlimmern; in den Händen von Elon Musk und dem argentinischen Präsidenten Javier Milei ist sie auch eine politische Waffe und ein Umverteilungsinstrument.
Deutschland kann die Erneuerung Europas vorantreiben – wenn es diesen Moment nutzt – Artikel
Timothy Garton Ash, The Guardian, 26.02.2025
Dreimal hat Deutschland in der Nachkriegszeit strategische Entscheidungen getroffen, die Europa zugute kamen – mit den USA an seiner Seite. Jetzt muss es dies in Opposition zu Trump tun.
US-Rohstoffkolonie? Diesen Deal bietet Trump der Ukraine – Artikel (Paywall)
Moritz Koch, Mareike Müller, Handelsblatt, 25.02.2025
Die neue US-Regierung will sich für die Unterstützung der Ukraine kompensieren lassen. Dem Handelsblatt liegt ein aktueller Entwurf für einen umstrittenen Wiederaufbaufonds vor.
Höhere US-Autozölle dürften deutsche Stahlindustrie hart treffen – Artikel
Der Spiegel, 28.02.2025
Deutschlands Stahlbranche steckt schon heute in der Krise. Verhängt US-Präsident Donald Trump nun auch höhere Autozölle, droht ein weiterer Rückschlag: In den Fahrzeugen steckt viel Stahl aus der Bundesrepublik.
„Noch haben wir die Chance, die Industrie erfolgreich zu modernisieren“ – Artikel (Paywall)
Interview von Jan Diesteldorf und Josef Kelnberger mit EU-Kommissarin Teresa Ribera, Süddeutsche Zeitung, 26.02.2025
Teresa Ribera ist eine der mächtigsten Frauen Europas. Die spanische Sozialistin soll Europas Klimapolitik verteidigen und zugleich der Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Das, sagt sie, sei überhaupt kein Widerspruch.
Deutschland braucht eine Investitionsoffensive: Ein Fünf-Punkte-Plan für die neue Bundesregierung – Artikel
Marcel Fratzscher, Tagesspiegel, 18.02.2025
Deutschland hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Die neue Bundesregierung muss daher einen Kurswechsel in der Wirtschafts- und Finanzpolitik vollziehen. Die Lösungen liegen auf der Hand. Ein Gastbeitrag von Marcel Fratzscher.
Deutschland braucht Investitionsanreize – doch mit klugen Konditionen – Artikel (Paywall)
Patrick Kaczmarczyk, Surplus Magazin, 18.02.2025
SPD und Grüne fordern in ihrem Wahlprogramm Investitionsprämien. Doch die werden nicht an Bedingungen wie Klimaschutz oder gute Arbeitsbedingungen geknüpft.
Für AfD-Wähler fühlt sich alles viel teurer an – Artikel (Paywall)
Dana Hajek und Jan Guldner, ZEIT ONLINE, 12.02.2025
Wie stark Menschen Inflation wahrnehmen, hängt auch mit ihrer Wahlabsicht zusammen, zeigen neue Daten. Die gefühlte Teuerung ist am stärksten an den politischen Rändern.
Stimmt das eigentlich, dass die Ungleichheit in Deutschland zunimmt? Artikel (Paywall)
Alena Kammer, ZEIT ONLINE, 20.02.2025
Die Ungleichheit bei Vermögen und Einkommen nehme zu, schreiben BSW und Linke in ihren Wahlprogrammen. Doch ganz so einfach ist das nicht. Was die Zahlen zeigen.
Elon Musks Milliarden gehen uns alle an – Artikel (Paywall)
Gastbeitrag von Gerhard Schick, ZEIT ONLINE, 13.02.2025
Musk hat 400 Milliarden. Allein der reichste Deutsche besitzt 100.000-mal so viel wie ein deutscher Durchschnittshaushalt. Vermögensteuer hilft? Falsch!
Vergessen Sie die USA – Europa hat erfolgreich Zölle auf sich selbst erhoben – Artikel (Paywall)
Mario Draghi, Financial Times, 17.02.2025
Hohe interne Barrieren und regulatorische Hürden sind für das Wachstum weitaus schädlicher als alles, was Amerika vorschreiben könnte.
Wie europäische Verteidigungsbonds funktionieren könnten – Artikel
Sander Tordoir, IPQ, 13.02.2025
Die gemeinsame Emission von EU-Schulden ist keine Bazooka von der Stange. Damit Anleihen funktionieren, sind Kompromisse unvermeidlich und echte Steuereinnahmen erforderlich.
Xi lässt die Welt für Chinas Fehler zahlen – Artikel (Paywall)
Brad Setser, New York Times, 18.02.2025
Trumps Zölle sind schlimm genug, aber Xi verzerrt den Welthandel grundlegend, um China aus dem Loch zu ziehen, das seine wirtschaftlichen Entscheidungen verursacht haben.
Beim Handel geht es nicht nur um Trump – Artikel (Paywall)
Rana Foroohar, Financial Times, 17.02.2025
Die Weltwirtschaft und der Welthandel verändern sich auf eine Weise, die nichts mit den Zolldrohungen des US-Präsidenten zu tun hat.
Tooze: Das Ende der Globalisierung – Artikel (Paywall)
Adam Tooze, Surplus Magazin, 14.02.2025
Die zweite Amtszeit Trumps markiert das Ende der vertrauten Globalisierung. Wie Europa auf ein drohendes Wirtschaftschaos reagieren kann, erklärt Adam Tooze.
Die Normalisierung der extremen Rechten wird zur Normalität – Artikel (Paywall)
Jan-Werner Mueller, Project Syndicate, 17.02.2025
Die Geschichte und die sozialwissenschaftliche Forschung zeigen, dass sich die Wähler an den Eliten orientieren. Wenn Politiker, die als Mainstream angesehen werden, eine rechtsextreme Partei als normal behandeln, wird die öffentliche Meinung dazu neigen, dem zu folgen; und wenn eine solche Normalisierung erst einmal stattgefunden hat, wie heute in Europa, ist es praktisch unmöglich, sie rückgängig zu machen.
Europa Allein – Artikel (Paywall)
Daniela Schwarzer, Project Syndicate, 20.02.2025
Die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz machte deutlich, dass die lange Nachkriegsära des Atlantizismus vorbei ist und dass die Europäer ihre Souveränität nun selbst in die Hand nehmen müssen. Die Ressourcen dafür sind reichlich vorhanden, es bedarf nur des gemeinsamen politischen Willens.
Neue Gedanken zur ökonomischen Debatte der Biden-Jahre – Blogpost
Mike Konczal, Substack, 14.02.2025
Eine kritische Antwort auf Jason Furmans Artikel „Post-Neoliberal Delusion and the Tragedy of Bidenomics“, der sich sowohl mit der Regierung als auch mit den Ideen der letzten vier Jahre auseinandersetzt.
The post-neoliberale Illusion – Artikel
Jason Furman, Foreign Affairs, 10.02.2025
Und die Tragödie von Bidenomics.
Keine Illusionen: Bidenomics war nicht perfekt, aber es hat viele großartige Dinge bewirkt – Blog
Jared Bernstein, Substack, 12.02.2025
Eine Antwort auf Jason Furman.
Eine echte post-neoliberale Agenda – Artikel
Marshall Steinbaum, Boston Review, 11.02.2025
Bidenomics scheiterte an zehn Jahren des Widerwillens der Demokraten, der Ungleichheit den Kampf anzusagen.
Den Austeritätskonsens der Wirtschaftswissenschaften brechen – Artikel
Clara E. Mattei, Jacobin, 06.02.2025
Wirtschaftsfakultäten in den Vereinigten Staaten halten sich sklavisch an den Mainstream-Konsens über Sparmaßnahmen und den freien Markt. Das Center for Heterodox Economics glaubt, dass es einen besseren Weg gibt.
Die falsch verstandene Exportweltmeisterschaft – Artikel (Paywall)
Heike Buchter, ZEIT ONLINE, 10.02.2025
Trump hat recht: Deutschlands Exportüberschüsse sind ein Problem – für deutsche Arbeitnehmer. Denn die Gewinne landen nur bei wenigen Wohlhabenden.
Wie sich der Handelskrieg über Zölle hinaus ausweiten könnte – Artikel
Peter R. Orszag, Washington Post, 13.02.2024
Andere Länder können sich auf vielfältige Weise gegen die Vereinigten Staaten wehren.
Die Strategie der EU gegen Trumps Zölle: Eine eiserne Faust im Samthandschuh – Artikel
Camille Gijs, Politico, 13.02.2024
Brüssel hat sein Handelsinstrumentarium seit Donald Trumps erster Amtszeit verstärkt. Aber es bräuchte die breite Unterstützung der EU-Länder, um hart zurückzuschlagen.
Die EU braucht den Mut, sich eine andere digitale Wirtschaft vorzustellen – Artikel (Paywall)
Martin Sandbu, Financial Times, 09.02.205
Trumps Tech-Oligarchen haben Angst vor Europas Regulierungsmacht – und das sollten sie auch sein.
„Die Union präsentiert uns nur Scheinlösungen“ – Interview
Interview von Simon Poelchau mit Sebastian Dullien, taz, 10.02.2025
Die öffentliche Infrastruktur ist in Deutschland auf dem Stand des späten 20. Jahrhunderts, sagt Ökonom Sebastian Dullien. Es brauche Investitionen.
Wenn warme Zimmer zum Luxus werden – Artikel
Annika Joeres, ZEIT ONLINE, 12.02.2025
Die CDU plant, das Heizungsgesetz wieder abzuschaffen, und setzt auf den CO₂-Preis. Doch eine neue Studie zeigt: Der müsste stark steigen, um Ähnliches zu erreichen.
Studie: Jede zweite erwerbstätige Frau ohne Existenzsicherung – Artikel
Süddeutsche Zeitung, 12.02.2025
Bei 53 Prozent der arbeitenden Frauen reicht das Einkommen laut einer Untersuchung nicht für eine langfristige Existenzsicherung. DGB-Vizechefin Hannack fordert, Väter in der Sorgearbeit zu stärken.
Sie wollen nicht den wilden Markt. Und auch nicht den Vollkaskostaat. – Artikel (Paywall)
Thomas Fricke, ZEIT ONLINE, 05.02.2025
Der Wahlkampf um die Wirtschaftspolitik geht an den Bedürfnissen der Menschen gefährlich vorbei. Eine große Befragung zeigt: Die meisten wollen einen aktiven Staat.
Deutsche hadern gleichermaßen mit Markt und Staat. – Artikel (Paywall)
Stephan Lorz, Börsen-Zeitung, 05.02.2025
Die Bürger eint zwar eine marktkritische Grundhaltung, aber von kleinteiligen Eingriffen der Politik halten sie auch nichts, zeigt eine Umfrage. Doch eine inhaltliche kursbestimmende Debatte darüber bleibt im Wahlkampf aus.
Wandel in deutscher Wirtschaft – wie viel Industrie benötigt unser Land? – Artikel
Jonas Nonnenmann, Frankfurter Rundschau, 07.02.2025
In Deutschland ist die Industrie nach wie vor stärker als in anderen wohlhabenden Nationen. Der gesamte Bereich durchläuft einen Wandel. Eine Untersuchung.
Ein Fair New Deal für Deutschland – Artikel
Tom Krebs und Isabella M. Weber, Wirtschaftsdienst (2025 / Heft 1)
Dieser Beitrag ist Teil von Neuwahlen in Deutschland: Empfehlungen an die neue Bundesregierung
Mehr Kredite, weniger Schulden – Artikel (Paywall)
Claus Hulverscheidt, Süddeutsche Zeitung, 05.02.2025
Angesichts des Investitionsstaus fordern Experten vom Staat ein kreditfinanziertes Ausgabenpaket von bis zu 600 Milliarden Euro. Eine Studie zeigt: Das geht – und die Schuldenquote sinkt trotzdem.
Investitionen und Industriepolitik statt Scheinlösungen – Artikel
Sebastian Dullien, Surplus Magazin, 05.02.2025
Steuerfreie Überstunden, Karenztage bei Krankheit, Entlastung für die Reichsten – all das sind Scheinlösungen gegen die Wirtschaftsschwäche, meint Sebastian Dullien.
„Alle sind nach rechts gerückt? Das ist zu pauschal“ – Interview (Paywall)
Sebastian Beer und Helen Greiner, ZEIT ONLINE, 05.02.2025
Bei der Wahl erwartet die AfD ein Rekordergebnis. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach warnt dennoch davor, den Deutschen einen Rechtsruck zu attestieren.
Trumps Industriepolitik weist mehr Kontinuität als Disruption auf – Artikel (Paywall)
Elisabeth Reynolds, Project Syndicate, 31.01.2025
Trotz der disruptiven Auswirkungen von Donald Trumps ersten Wochen zurück im Weißen Haus ist der Präsident nicht weit von der Industriepolitik seines Vorgängers abgewichen. Die Herausforderung für Trump wird darin bestehen, die richtige Mischung aus Anreizen (Subventionen) und Sanktionen (Zölle) zu entwickeln und umzusetzen, um einen global wettbewerbsfähigen Fertigungssektor zu schaffen
Es gibt mehrere Gründe, warum Musk das Zahlungssystem des US-Finanzministeriums kontrollieren möchte. Keiner davon ist gut.– Artikel
Lindsay Owens, MSNBC, 01.02.2025
Ein nicht gewählter und nicht rechenschaftspflichtiger Milliardär möchte bestimmen, was sich hart arbeitende Familien leisten können und was nicht.
Könnte sich der Welthandel von den USA entkoppeln? – Artikel (Paywall)
Martin Sandbu, Financial Times, 06.02.2025
Die meisten Länder sind weniger abhängig von Exporten nach Amerika, als man denkt.
Was läuft in der deutschen Wirtschaft schief? – Artikel (Paywall)
Michael Spence, Project Syndicate, 30.01.2025
Deutschland wurde teilweise zu einer europäischen Macht, weil seine Industriesektoren in den frühen 2000er Jahren die wertschöpfungsstärksten Segmente der globalen Lieferketten übernahmen. Um diesen Erfolg heute zu wiederholen, müsste Deutschland an die Spitze der digitalen Transformation treten, und das kann es nicht ohne die EU.
Deutschlands Omertà zur Schuldenbremse kostet es teuer– Artikel (Paywall)
Shahin Vallée, Financial Times, 29.01.2025
Die fiskalischen Regeln des Landes ersticken dringend benötigte Investitionen und schaffen falsche Anreize für seine europäischen Partner.
Dieses Gesetz wird Deutschland schaden – Artikel (Paywall)
Eine Kolumne von Marcel Fratzscher, Die ZEIT, 31.01.2025
Die Union um Friedrich Merz bringt ein umstrittenes Gesetz ins Parlament ein, um die Migration zu begrenzen. Sie gefährdet damit auch Deutschlands Wohlstand.
Wie die Normalisierung der radikalen Rechten deren Wahlerfolge begünstigte – Artikel
Vicente Valentim, Makronom, 27.01.2025
Der Aufstieg der radikalen Rechten ist weniger das Ergebnis eines plötzlichen Sinneswandels der Wähler, sondern vielmehr das Produkt einer schleichenden Normalisierung, die bisher verborgene Ansichten ans Licht bringt.
Trumps neuer Wirtschaftskrieg – Artikel (Paywall)
Sam Fleming, Ben Hall, Claire Jones, Emma Agyemang, Financial Times, 24.01.2025
Die Ultimaten und Forderungen des Präsidenten an Verbündete und Rivalen deuten darauf hin, dass er die finanzielle Macht Amerikas als Knüppel einsetzen wird.
Der neue Washington Consensus – Artikel (Paywall)
Katharina Pistor, Project Syndicate, 28.01.2025
Wenn ein Bild mehr sagt als tausend Worte, dann ist das Bild der Big-Tech-Gründer und CEOs, die bei Donald Trumps Amtseinführung in der ersten Reihe saßen, ein Manifest. Wir haben gerade gesehen, wie die Privatwirtschaft am helllichten Tag die US-Regierung übernommen hat, und die Geschichte zeigt, dass dies nicht gut ausgehen wird.
Wirtschaftliche Entwicklung nach dem Washington Consensus – Artikel (Paywall)
Karim El Aynaoui und Hinh T. Dinh, Project Syndicate, 28.01.2025
In der heutigen Weltwirtschaft müssen sich die Entwicklungsländer einen neuen politischen Rahmen zu eigen machen, der ihre makroökonomische Widerstandsfähigkeit stärkt, Technologie für Produktivitätswachstum nutzt und Wachstum und Strukturwandel begünstigt. Nichts davon wird mit einer „jedes Land für sich“-Mentalität möglich sein.
Weber: Inflation stürzt Regierungen – Artikel (Paywall)
Isabella Weber, Surplus Magazin, 25.01.2025
Von der römischen Antike bis zur Biden-Ära: Immer wieder stürzen Regierungen durch die Inflation. Doch dagegen gibt es etliche gute Maßnahmen.
Klimaschutz hilft dem Standort! – Artikel
Ein Gastbeitrag von Michael Hüther und Ottmar Edenhofer, Die ZEIT, 28.01.2025
Die Klimaziele zu hinterfragen, ist ein schwerer Fehler: Die Unternehmen haben ihre Strategien längst daran ausgerichtet. Ein Plädoyer eines ungewöhnlichen Autorenduos.