DER STAAT
ReLive: Bürokratieabbau, aber wie? New Economy Short Cut mit Patrick Bernau, Georg Diez und Johanna Sieben
Bürokratie galt einst als Errungenschaft – heute steht sie unter Dauerbeschuss. Was ist wirklich überflüssig, was notwendig? Und wie viel Regelwerk wollen wir eigentlich selbst? Darüber diskutierten wir im New Economy Short Cut am 28. Oktober mit Patrick Bernau, Georg Diez und Johanna Sieben.
VON
FORUM NEW ECONOMYVERÖFFENTLICHT
17. OKTOBER 2025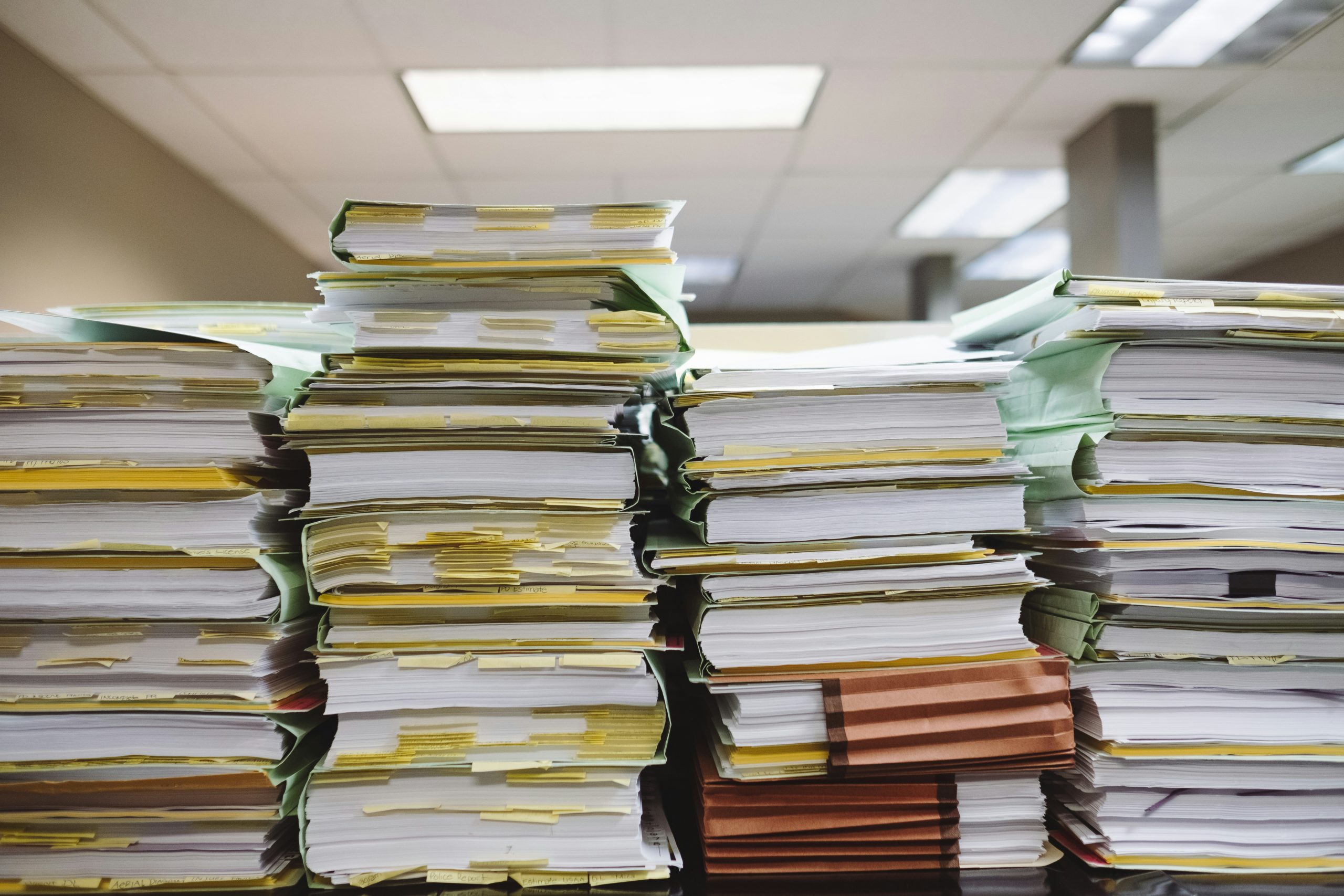
Kaum ein Thema wird in Deutschland so emotional diskutiert wie der Bürokratieabbau. Von der „Kettensäge gegen das Monster“ ist oft die Rede, doch trotz jahrzehntelanger Forderungen bleibt der tatsächliche Fortschritt überschaubar. Warum ist das so? Und was wäre ein klügerer Weg, mit Verwaltung und Regulierung umzugehen? Beim New Economy Short Cut im November diskutierten darüber Patrick Bernau (FAZ, Autor von Bürokratische Republik Deutschland), Johanna Sieben (Direktorin des Creative Bureaucracy Festivals) und Georg Diez (Fellow bei Project Together und dem Max-Planck-Institut).
Bernau eröffnete die Diskussion mit einem Blick auf das Kernproblem: Bürokratie ist nicht einfach überflüssig, sondern oft ein Symptom struktureller Überforderung. In Krankenhäusern etwa verbringen Beschäftigte bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation – Zeit, die in der Pflege fehlt. Das sei kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer „Policy Accumulation“: Immer neue Vorschriften werden auf bestehende geschichtet, bis niemand mehr den Überblick hat. Die Folge: Gesetze verlieren ihre Wirkung, Verwaltung kann sie kaum noch umsetzen – eine Spirale, die politische Handlungsfähigkeit untergräbt.
Zugleich, so Bernau, tragen moralische Imperative – etwa beim Klima- oder Verbraucherschutz – zur Überregulierung bei, weil sie die Debatte moralisch aufladen: „Wer gegen eine Maßnahme ist, gilt schnell als egoistisch.“ Damit gehe der Sinn einzelner Regeln verloren. Ein nachhaltiger Bürokratieabbau müsse daher vor allem eines tun: aufzuräumen – in Zuständigkeiten, in Gesetzeslagen und in der Verwaltungskultur selbst.
Johanna Sieben brachte eine andere Perspektive ein: Statt nur über Abbau zu reden, brauche es vor allem Vertrauen – zwischen Staat und Bürgern, Bürgern und Staat sowie innerhalb der Verwaltung. Misstrauen führe zu endlosen Prüfketten und Formularen, die alle Beteiligten lähmen. Erfolgreiche Projekte entstünden dort, wo Verwaltungen kooperativ, experimentell und mutig handeln. Ein Beispiel: Eine ressortübergreifende digitale Plattform wurde dank enger Zusammenarbeit von Kanzleramt und Verteidigungsministerium in nur drei Monaten umgesetzt – möglich, weil man „einfach mal zum Telefonhörer gegriffen“ habe.
Für Sieben sind Ermessensspielräume und Sandboxes – geschützte Räume zum Ausprobieren neuer Lösungen – entscheidend, um Vertrauen zu stärken und Fehlerkultur zu ermöglichen. Verwaltung brauche mutige Führungskräfte, die Mitarbeitende ermächtigen, Verantwortung zu übernehmen, und Strukturen, die Innovation nicht bestrafen.
Georg Diez schließlich rückte das Thema in einen größeren historischen und politischen Rahmen. Bürokratie, so seine These, sei ein Spiegel des Staatsverständnisses – und dieses stecke im 19. Jahrhundert fest. Wenn Verwaltung heute handlungsfähig bleiben solle, müsse sich auch das Bild vom Staat ändern: weg vom hierarchischen, entkoppelten Apparat hin zu einem gestaltenden, bürgerzentrierten Staat, der mit gesellschaftlichen Veränderungen Schritt hält. Das erfordere, so Diez, auch eine Reform des Föderalismus, der vielerorts zu einem „rationalen System in irrationaler Konstruktion“ geworden sei.
Ein Schlüssel zur Erneuerung liege in der Digitalisierung – und in der intelligenten Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Für Sieben ist klar: KI ist kein optionales Tool, sondern ein Muss. Sie könne Verwaltung massiv entlasten, wenn Transparenz, Ethik und Befähigung der Mitarbeitenden gewährleistet seien. KI könne Routineaufgaben übernehmen – aber Vertrauen und Verantwortung bleiben menschliche Aufgaben.
Am Ende der Diskussion stand ein gemeinsamer Gedanke: Bürokratieabbau ist kein Selbstzweck und kein Krieg gegen Regeln. Es geht um die Erneuerung des Staates – darum, wie er Vertrauen schafft, effizient arbeitet und den Bürgerinnen und Bürgern dient. Oder, wie Georg Diez es formulierte: „Der Staat ist nicht das Andere – der Staat sind wir alle.“
Fragen aus dem Chat
Im Anschluss an die Veranstaltung beantwortete Patrick Bernau noch zahlreiche Fragen aus dem Chat – und lieferte damit weitere Einblicke in seine Analyse:
Auf die Frage nach der Ifo-Grafik (Abbildung 1 und 2) zu den Bruttolöhnen verwies er auf den Ifo-Forschungsbericht 159 zum integrierten Sozialtransfersystem. Die dort gezeigten Kurven verdeutlichen, wie stark Sozialabgaben und Transferleistungen dazu führen können, dass sich Mehrarbeit in bestimmten Einkommensbereichen kaum lohnt.
Auch zur erwähnten Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung lieferte Bernau die Quelle nach: Von 1500 untersuchten Klimaschutzmaßnahmen zeigten nur 63 messbare Emissionsreduktionen – ein Beleg für die These, dass moralisch gut gemeinte Politik oft wirkungslos bleibt, wenn sie nicht überprüft wird.
Zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz zeigte sich Bernau vorsichtig optimistisch: KI könne helfen, Gesetzestexte konsistenter zu gestalten und Widersprüche zu erkennen. Zugleich warnte er vor einem „Skifahrer-Helm-Effekt“: Je besser die technische Unterstützung, desto komplexer könnten Regelwerke werden – und am Ende müssten sie weiterhin Menschen befolgen.
Auf die Frage, wie man mit Interessengruppen umgehen solle, die an bestehenden Regeln festhalten, sagte er: Man werde manche enttäuschen müssen. Doch schon eine effizientere Verwaltung und das Streichen überholter Vorschriften könnten große Fortschritte bringen, „ohne irgendjemandem zu schaden“.
Einem Einwand, Bürokratieabbau diene vor allem den Reichen, widersprach Bernau entschieden: Effiziente Verwaltung sei im Gegenteil bürgerfreundlicher. Das zeige sich etwa in Berlin, wo Verwaltungsmodernisierung zu schnelleren Terminen und digitaler Erreichbarkeit geführt habe.
Wichtige Ursachen für den Reformstau sieht Bernau auch im juristischen Überhang deutscher Behörden: „Kaum eine Verwaltung hat so viele Juristen wie die deutsche.“ Die Angst vor Rechtsfolgen und Urteilen lähme Innovation – ein Punkt, den er auch in seinem Buch weiter ausführt.
Schließlich präzisierte Bernau eine vielzitierte Zahl aus der Diskussion: Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wurden in den vergangenen drei Jahren rund 300.000 zusätzliche Arbeitskräfte allein benötigt, um neue bürokratische Anforderungen zu bewältigen – bei insgesamt etwa 550.000 neuen sozialversicherungspflichtigen Stellen.
Diese Nachfragen zeigten, wie groß das Interesse an den Strukturen hinter der Bürokratie ist – und wie viel Potenzial in einem differenzierten Blick auf das steckt, was oft pauschal als „Verwaltungsversagen“ gilt.
