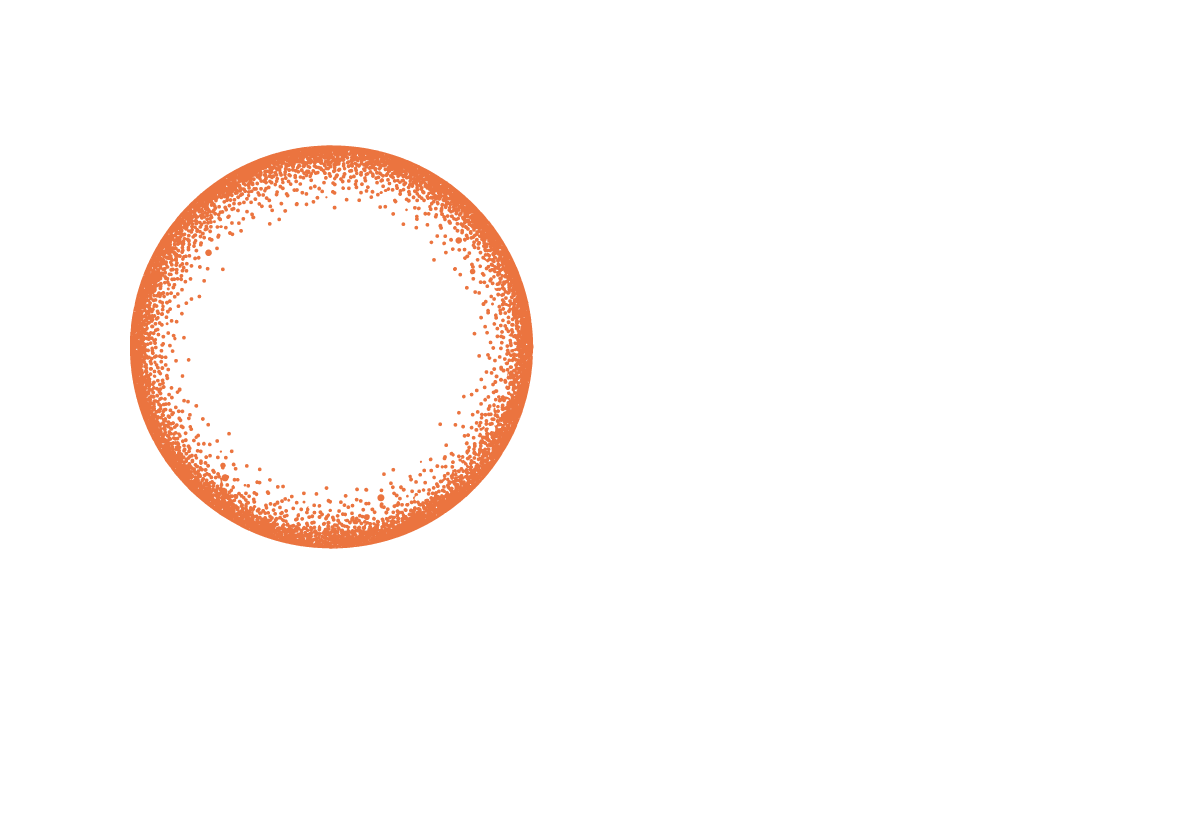Knowledge Base
Der Staat
Jahrzehnte lang galt der Konsens, dass sich der Staat aus der Wirtschaft zurückziehen und man die Staatsschulden senken sollte, um den Wohlstand zu fördern. Dies hat jedoch zu chronischen Mängeln in Bildung und Infrastruktur geführt. Neuere Forschung versucht zu erörtern wann es sinnvoll ist, dass sich der Staat in den Wirtschaftsprozess einmischt um langanhaltenden Wohlstand zu garantieren und Krisen zu verhindern.
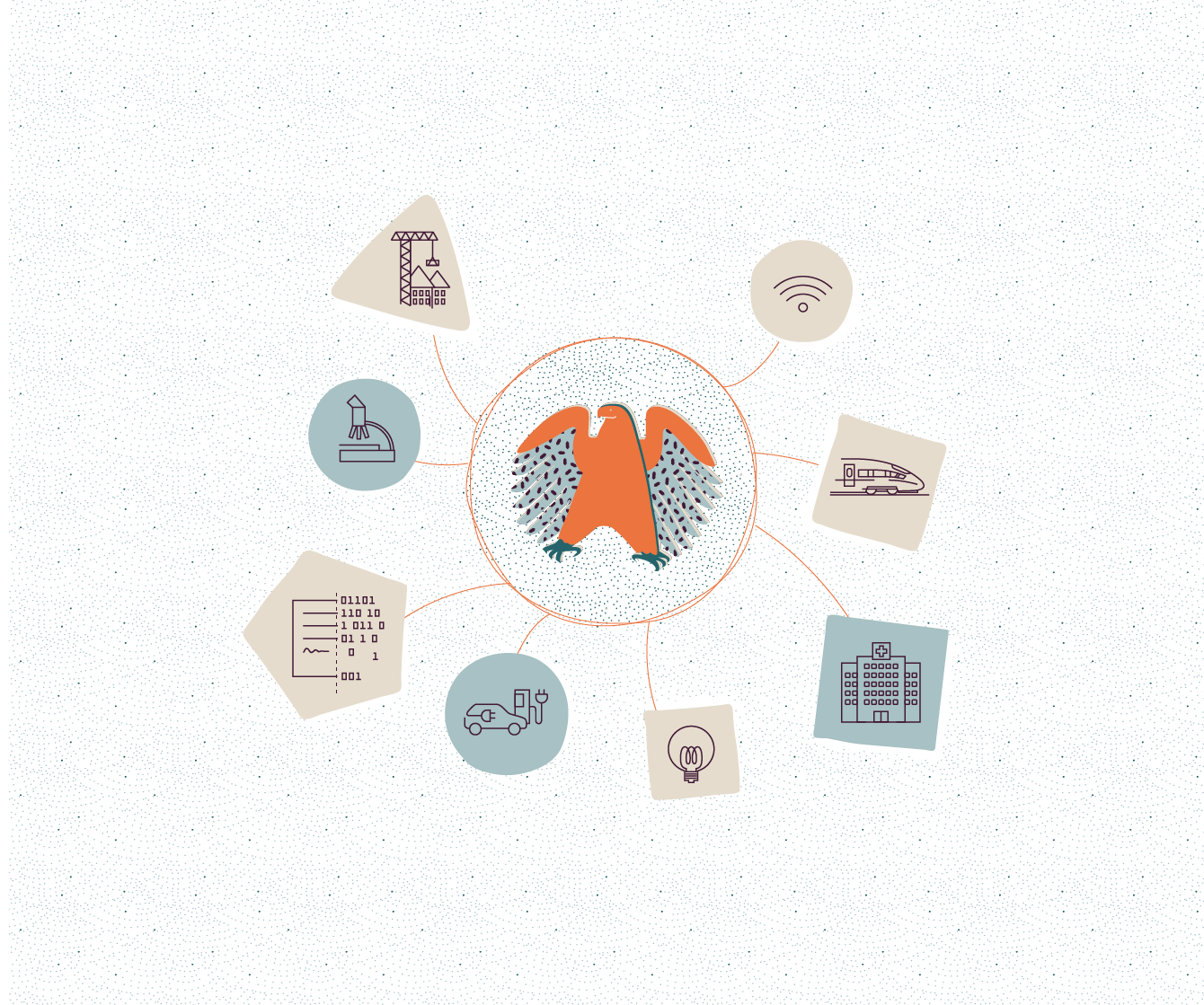
Die Herausforderung
Jahrzehnte lang galt der Konsens, dass sich der Staat aus der Wirtschaft zurückziehen und man die Staatsschulden senken sollte, um den Wohlstand zu fördern.
Deutsche Unternehmen klagen immer wieder über unzureichende öffentliche Infrastruktur als Grund dafür, dass sie nicht mehr produzieren können. Der Grund: über viele Jahre ist offenbar zu wenig in Straßenbau, Eisenbahnen, Schulen und Universitäten sowie digitale Dienste, das Gesundheitssystem oder die Umstellung auf Elektromobilität und andere klimaschonende Infrastruktur investiert worden.
Nach Schätzungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau hat sich allein bei den Kommunen fast 160 Milliarden an Investitionsbedarf zur Erneuerung von Brücken oder Kanalisationen angestaut (Krone und Scheller, 2018). Für den Bund schätzen das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und das Institut der deutschen Wirtschaft den Investitionsbedarf auf knapp 600 Mrd. Euro über ein Jahrzehnt (Dullien et al., 2024).
Die Gesamtquote öffentlicher Investitionen gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagniert in Deutschland seit vielen Jahren um oder knapp über zwei Prozent.
Anfang der 1990er Jahre lag sie noch bei knapp über 3 Prozent (Statistisches Bundesamt, 2019). Und dort, wo Investitionen seit geraumer Zeit wieder erhöht werden sollen, fehlen mittlerweile oft die Kapazitäten bei Bau- und Planbehörden oder entsprechend qualifizierte Kräfte, die staatlicherseits Investitionen anschieben könnten.
Was für Deutschland in besonderem Maße gilt, gilt für einen Großteil der reicheren Länder im Westen. Dramatische Mängel in der Infrastruktur werden in Großbritannien ebenso beklagt wie in den USA oder Italien und Frankreich. Noch bedenklicher ist die Lage in Euro-Ländern, die von der Währungs- und Finanzkrise besonders getroffen wurden. In Spanien und Irland sank der Anteil öffentlicher Investitionen am BIP zwischen 2007 und 2015 um 2,3 bzw. 2,8 Punkte (OECD, 2017). Im Jahr 2022 verzeichneten Deutschland, Irland und Portugal mit jeweils knapp über zwei Prozent die niedrigsten öffentlichen Nettoinvestitionsquoten in der EU (Dany-Knedlik et al., 2025).
Was schiefgelaufen ist
Die Rolle des Staates zu verringern wurde als effektivstes Mittel gesehen um hohes Wirtschaftswachstum zu erzeugen.
Einer der grundlegenden und zentralen Lehrsätze des Marktliberalismus seit den späten 1970er Jahren lautet, dass wirtschaftliche Dynamik ein Minimum an staatlicher Tätigkeit erfordert. Der große Monetarist und Nobelpreisträger Milton Friedman sagte einmal: „Niemand gibt das Geld eines anderen so klug aus, wie er sein eigenes ausgibt“, und weiter: „Wenn man also Effizienz und Effektivität will, wenn man will, dass das Wissen richtig genutzt wird, muss man dies mit den Mitteln des Privateigentums tun.“
Damals begann eine ganze Ära, in der zahlreiche Akademiker versuchten, die Nutzlosigkeit fast jeder staatlichen Intervention durch immer kreativere Theorien zu untermauern. So argumentierte beispielsweise der angebotsorientierte Wirtschaftswissenschaftler Arthur Laffer, dass Steuersenkungen (insbesondere für Reiche) genügend zusätzliche wirtschaftliche Aktivität schaffen würden, um den anfänglichen Verlust an Steuereinnahmen mehr als auszugleichen; das heißt, Steuersenkungen würden sich selbst auszahlen. Die Theorie der rationalen oder adaptiven Erwartungen besagt ihrerseits, dass die Menschen als Reaktion auf höhere Staatsausgaben nicht mehr von ihrem eigenen Geld ausgeben werden, weil sie davon ausgehen, dass früher oder später die Steuern steigen müssen. (Barro, 1979). Eine andere Theorie – die der „expansiven fiskalischen Sparsamkeit“ – behauptet, dass harte Sparmaßnahmen zwar zunächst die Inlandsnachfrage schwächen, letztlich aber zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum führen, da die Zinssätze (aufgrund des Abbaus der Staatsverschuldung) sinken. (Alesina und Ardagna, 1998, 2010).
Dieses neue Leitprinzip wurde in der Praxis vor allem seit der Wahl von Margaret Thatcher im Vereinigten Königreich 1979 und Ronald Reagan in den USA 1981 angewandt. Thatchers Zitat von 1987 wurde berühmt. Sie sagte: „… so etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt einzelne Männer und Frauen und es gibt Familien. Und keine Regierung kann irgendetwas tun, außer durch die Menschen, und die Menschen müssen sich zuerst um sich selbst kümmern.“ Reagan erklärte 1981: „Die Regierung ist nicht die Lösung für unser Problem, die Regierung IST das Problem“.
In beiden Ländern wurden daraufhin zahlreiche zuvor staatlich erbrachte Dienstleistungen privatisiert. Außerdem wurden Sozialleistungen und öffentliche Investitionen gekürzt. Deutschland und andere europäische Länder folgten bald und machten es sich zum Grundsatz, dass auch die Staatsausgaben und die Steuern so weit wie möglich gesenkt werden sollten. Dies wiederum erhöhte den Druck, die Staatsausgaben zu senken.

Gleichzeitig geriet seit Anfang der 1980er Jahre die Idee in Verruf, dass Regierungen zumindest während einer Wirtschaftskrise der Nachfrageschwäche des privaten Sektors durch Ausgabenerhöhungen oder Steuersenkungen entgegenwirken sollten. Das Diktum, die Rolle des Staates zu reduzieren, wurde auch Teil des berühmten Washington Consensus, der bald nicht nur die Politik der US-Regierung, sondern auch die Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds an die Krisenländer bestimmte. Darüber hinaus prägte der Geist von Milton Friedman und anderen Anhängern der marktwirtschaftlichen Orthodoxie auch den Vertrag von Maastricht, der den politischen Rahmen für die Währungsunion in Europa absteckte und dessen oberste Priorität die Begrenzung und Verringerung der Staatsdefizite und der öffentlichen Verschuldung war, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage.
Natürlich wurde das Bestreben, die Rolle des Staates zu reduzieren, nicht so strikt umgesetzt, wie es sich die orthodoxen Marktliberalen vorgestellt hatten. So erhöhte die Reagan-Regierung die Militärausgaben so stark, dass die USA schon bald ein Staatsdefizit verzeichneten. Und lange Zeit herrschte eine weit verbreitete Skepsis, dass der Staat eingreifen sollte, um Wirtschaftszyklen zu glätten oder Innovationen in der Wirtschaft zu fördern.
In der EU, wie auch anderswo, führte die Fixierung auf die Verringerung der Haushaltsdefizite dazu, dass die Regierungen die Ausgaben kürzten, als ihre Volkswirtschaften bereits schwach waren, und damit den Abschwung noch verstärkten. Diese Kürzungen betrafen häufig vor allem Investitionen, da es politisch einfacher war, die Ausgaben für die Infrastruktur zu kürzen als für andere, eher strukturelle Ausgaben. Andererseits nutzten die Regierungen gute wirtschaftliche Zeiten zu wenig, um Defizite abzubauen. In der Wirtschaftssprache ausgedrückt, war die Finanzpolitik systematisch „prozyklisch“ und verschärfte die Konjunkturschwankungen eher, als dass sie sie minimierte. Vor allem Griechenland litt unter diesem Ansatz, denn die beispiellosen Sparmaßnahmen trugen zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um mehr als ein Drittel bei, ohne dass sich die grundlegende Dynamik der griechischen Wirtschaft verbessert hätte.
Jüngste empirische Untersuchungen deuten stark darauf hin, dass Sparmaßnahmen nur unter ganz bestimmten Umständen „expansiv“ sind, nämlich dann, wenn ein durch die Sparmaßnahmen verursachter Rückgang der Binnennachfrage durch ein starkes Exportwachstum mehr als ausgeglichen werden kann. Estland ist dies wohl gelungen, wenn auch um den Preis einer Abwanderung von meist jungen Arbeitnehmern. Eine solche Strategie ist jedoch nur möglich, wenn die wichtigsten Handelspartner des Landes gut dastehen, was während der Eurokrise nicht der Fall war.
Jüngsten Schätzungen zufolge haben der IWF und die Europäische Kommission die Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf die Wirtschaftsleistung systematisch unterschätzt.
In Griechenland beispielsweise war der erschwerende so genannte „Multiplikatoreffekt“ der Ausgabenkürzungen deutlich höher als angenommen.
Alles in allem trägt die Kombination aus dem Bestreben, die Rolle des Staates in der Wirtschaft zu reduzieren, Privatisierung und prozyklischer Finanzpolitik dazu bei, den dramatischen Verfall der öffentlichen Infrastruktur in Ländern wie Deutschland, den USA oder dem Vereinigten Königreich zu erklären.
Erste Lehren aus der Katastrophe
Das Bestreben, die Rolle des Staates in der Wirtschaft zu reduzieren, mag bestimmten Branchen zugute gekommen sein, aber es besteht ein zunehmender internationaler Konsens darüber, dass es fatale Nebeneffekte hatte. Der IWF hat eingeräumt, dass ihm während der Finanzkrise schwerwiegende Einschätzungsfehler unterlaufen sind. In der Eurozone wiederum setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass zu starre Defizitregeln Schaden anrichten, und man versucht verstärkt, die fiskalischen Ziele mit der wirtschaftlichen Situation des jeweiligen Landes in Einklang zu bringen. Der Schwerpunkt liegt nun mehr auf der Verringerung der „strukturellen Defizite“ – des Teils des Defizits, der nicht mit Konjunkturschwankungen zusammenhängt – und auf der Bereitschaft, die Auswirkungen des schwachen Wachstums auf die Haushaltslage anzuerkennen, anstatt Ausgabenkürzungen zu fordern, die die Wirtschaftstätigkeit und damit die öffentlichen Finanzen schwächen und damit weitere Ausgabenkürzungen erforderlich machen.
Angesichts des zunehmenden Rückstaus bei den Investitionsvorhaben stellen immer mehr Menschen die Vorzüge einer solch strengen Kontrolle der öffentlichen Ausgaben in Frage.
Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des Forum New Economy waren bereits 2019 rund 80 Prozent der Deutschen der Meinung, dass der Staat mehr Geld für Schulen, Straßen, Schienen und digitale Infrastruktur ausgeben sollte.
Auch waren rund 80 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen in Deutschland zu weit gegangen ist. Gemeinsame Schätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft und des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung gehen davon aus, dass Deutschland in den nächsten Jahren einen dreistelligen Milliardenbetrag investieren muss. Inzwischen scheint sich die Situation in anderen Ländern ähnlich zu entwickeln.
Die italienisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato hat festgestellt, dass die jahrelangen Ausgabenkürzungen und der Abbau von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst zusammen mit der Praxis der Kritik an der Kompetenz der öffentlichen Einrichtungen schädliche Auswirkungen haben. Je unattraktiver der öffentliche Dienst ist, desto schwieriger ist es für die staatlichen Institutionen, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen, die andere davon überzeugen können, eine Stelle in öffentlichen Einrichtungen anzunehmen. In Deutschland ist der Rückgang der Zahl der Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor ein wesentlicher Grund dafür, dass dem Staat heute oft die Kapazitäten fehlen, um öffentliche Investitionen zu fördern.
New Economy in Progress
Die Herausforderungen unserer Zeit zwingen uns, die Rolle des Staates und die Notwendigkeit einer aktiveren Finanzpolitik zu überdenken.
In neueren Studien zur Fiskalpolitik haben sich die Forscher vor allem darauf konzentriert, differenziertere und empirisch fundierte Gründe dafür zu finden, in welchen Fällen staatliche Aktivitäten aus ökonomischer Sicht sinnvoll sind und in welchen nicht.
Ein Teil dieser Forschung konzentriert sich auf die Multiplikatoren der Fiskalpolitik – mit dem Ergebnis, dass sich einerseits die Verstärkungsmechanismen als stärker erwiesen haben, als lange Zeit angenommen wurde. Andererseits ist die Effizienz wirtschaftspolitischer Maßnahmen offensichtlich stark von Zeitfaktoren und Umständen abhängig.

Andere Forscher haben versucht, die Effizienz staatlicher Investitionen zu kategorisieren, indem sie die erwarteten wirtschaftlichen und steuerlichen Erträge dieser Investitionen in der Zukunft geschätzt haben. Letztlich geht es darum, zu ermitteln, mit wie vielen zusätzlichen Einnahmen der Finanzminister in Zukunft rechnen kann, wenn er in eine bessere Infrastruktur und damit in eine höhere Wettbewerbsfähigkeit oder verbesserte Innovationsfähigkeit der Wirtschaft investiert. Wenn diese Erträge höher sind als die anfänglichen Kosten, ist dies ein starkes wirtschaftliches und finanzielles Argument für die entsprechende Investition – und umgekehrt (Krebs und Scheffel, 2016).
Ein dritter Forschungsstrang beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle die staatlichen Institutionen im Innovationsprozess des Privatsektors spielen. Eine vielzitierte Vorarbeit in diesem Bereich stammt von Mariana Mazzucato. Ihren Analysen zufolge haben öffentliche Behörden, wie z. B. das Militär, bereits eine wichtige Rolle bei der Entwicklung digitaler Technologien gespielt (z. B. das Iphone). Laut Mazzucato (2015) führt eine solche Diagnose zu einem Modell, bei dem staatliche und private Akteure in Zukunft viel enger zusammenarbeiten sollten, um sich an gemeinsamen langfristigen Missionen zu beteiligen. Eine solche Mission war das Projekt der 1960er Jahre, den ersten Menschen auf den Mond zu bringen. Heute sollte der Kampf gegen den Klimawandel mit einem ähnlich strategischen Ansatz angegangen werden.
Ebenso könnten staatliche Stellen eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, einen wichtigen Sektor wie die Autoindustrie bei der bevorstehenden Umstellung der Verkehrstechnologie zu unterstützen.
Eine weitere Frage, dies es zu beantworten gilt, betrifft die jeweilige Rolle von Zentralbanken und Regierungen, wenn es darum geht, auf deflationäre Tendenzen oder Inflationsschocks zu reagieren. Auf die Gefahr deflationärer Entwicklungen haben die Zentralbanken nach Ausbruch der Finanzkrise 2007/8 in unterschiedlichem Tempo und Ausmaß reagiert, indem sie eine unkonventionelle Politik einleiteten und auf den Märkten z.B. mit dem Ankauf von (Staats-)Anleihen reagierten. Diese Versuche sind jedoch nur teilweise wirksam, denn das zur Verfügung gestellte Geld führt nicht unbedingt zu mehr realen Ausgaben. Stattdessen hat es, wie Standardschätzungen nahelegen, zu einem Anstieg der Käufe von Vermögenswerten wie Aktien geführt.
Umgekehrt geriet nach dem Inflationsschock von 2021 in Zweifel, ob die Notenbanken wie üblich mit höheren Zinsen auf die Inflation reagieren sollten. Durch die Angebotsengpässe in der Covid-Pandemie und die Gaspreiskrise nach der russischen Invasion der Ukraine erlebte die Welt eine historische Inflationsepisode wie zuletzt in den 1970er Jahren. Wie Isabella Weber und andere argumentierten, helfen höhere Zinsen bei solchen vorübergehenden Preisschocks nur sehr bedingt. Als Alternative werden seither gezielte und zeitlich befristete Preiskontrollen diskutiert.